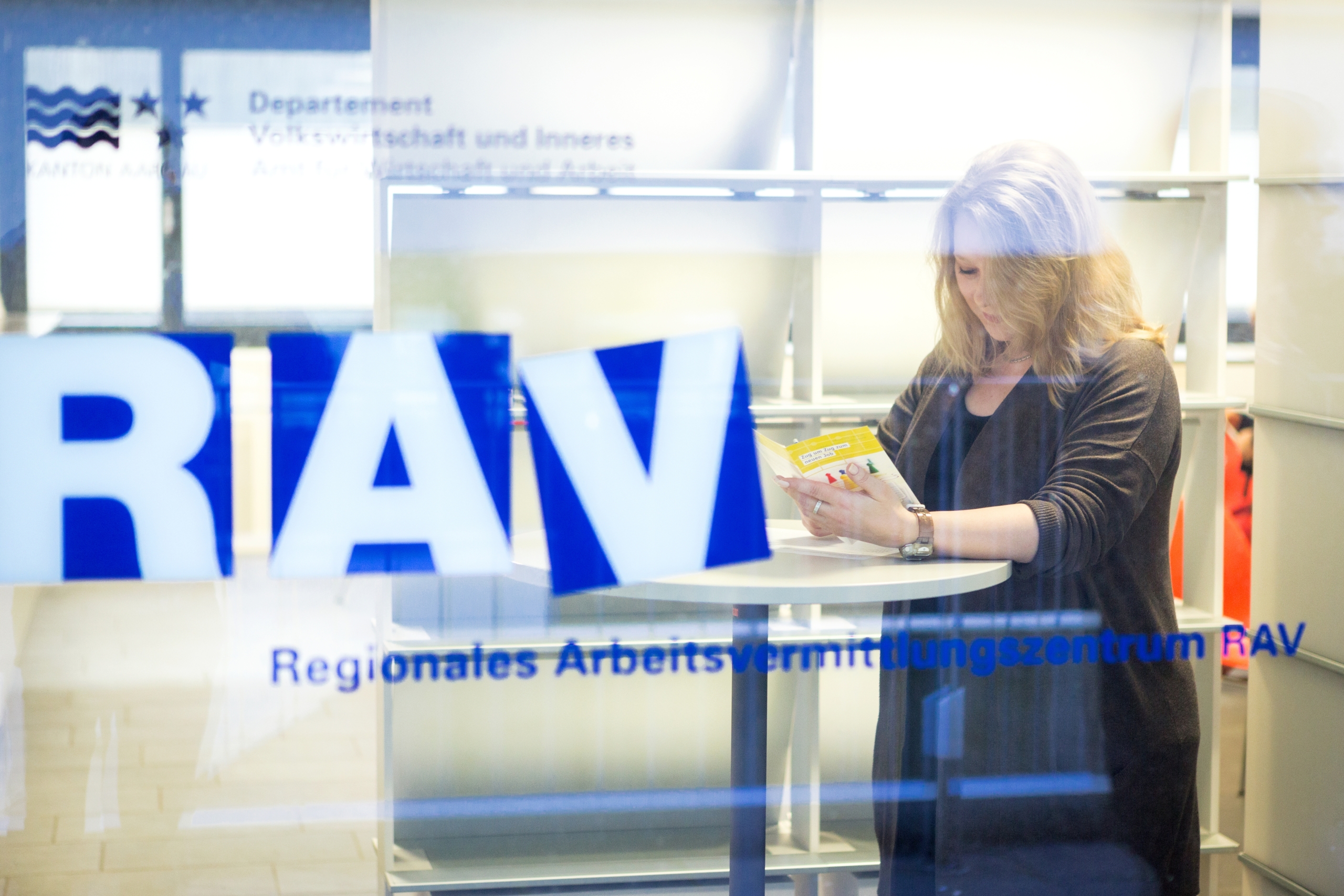Das Mega-Projekt «Enphor» – 7 Fragen, 7 Antworten
Bis zu 400 Millionen Franken könnten der Gemeindeverband Erzo und weitere Partner im nächsten Jahrzehnt am Standort Oftringen investieren. Ob das Vorhaben umsetzbar ist, soll nun eine Machbarkeitsstudie zeigen. Einerseits prüft die Erzo den Bau einer neuen Kehrichtverwertungsanlage (KVA), andererseits soll aus dem Klärschlamm des Abwassers Dünger in Form von Phosphor gewonnen werden. Der verbleibende Sand käme in der Bauwirtschaft zum Einsatz. Das Herzstück wäre die Produktion von Energie in Form von Fernwärme.
Das «enkeltaugliche Projekt» Enphor, wie es der Erzo-Vorstand bezeichnet, ist technisch und organisatorisch sehr komplex. Im letzten Teil der ZT-Serie beantworten wir sieben wichtige Fragen, die jetzt im Raum stehen.
1 Die Erzo kann dieses Projekt alleine nicht stemmen. Wer sind die Partner?
Die Erzo führt Gespräche mit zwei Partnern. Der Partner, mit dem man beim Bau und Betrieb der KVA zusammenarbeiten würde, informiert seine Eigentümer im August über ein mögliches Engagement beim Projekt Enphor – ab diesem Zeitpunkt soll dessen Name auch der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Bei der Klärschlammverwertung plant die Erzo eine Zusammenarbeit mit einem börsenkotierten Unternehmen. «Dessen Name wird erst publik, wenn gesicherte Informationen aus der Machbarkeitsstudie vorliegen», sagt Erzo-Vizepräsident Bruno Aecherli, der für die Kommunikation zuständig ist. Der Grund: «Eine zu frühe Information könnte für das Unternehmen zu einem Marktvorteil oder auch einem Marktnachteil führen.» Mit beiden Partnern hat die Erzo einen sogenannten Letter of Intent – also eine Absichtserklärung – unterschrieben.
2 Wer wurde mit der Machbarkeitsstudie beauftragt und wann liegt diese vor?
Im Wesentlichen arbeitet die Erzo mit der Rytec AG in Münsingen BE zusammen, einem Unternehmen, das sich auf Abfalltechnologie und Energiekonzepte spezialisiert hat. Die Rytec erhält nicht zum ersten Mal einen Auftrag von der Erzo; sie hat den regionalen Entsorgungsdienstleister schon früher beraten. Für einzelne Aspekte werden Experten beigezogen, beispielsweise Juristen oder Wirtschaftsprüfer, die auf Energieunternehmen spezialisiert sind. Die Machbarkeitsstudie soll spätestens Mitte 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
3 Falls die Studie zum Schluss kommt, dass das Projekt umsetzbar ist: Wie geht es nächstes Jahr weiter?
Die Erzo will zunächst intern mit den beiden Partnern klären, wie die Beteiligungen aussehen könnten – das soll im Laufe des ersten Quartals 2022 passieren. Danach bräuchte es die Zustimmung von Bund, Kanton und Gemeinden. Erst danach würde ein konkretes Bauprojekt gestartet. Die Machbarkeitsstudie liefert noch kein baubewilligungsfähiges Bauprojekt; dazu sind Investitionen von mehreren Millionen Franken notwendig.
4 Kern- und Knackpunkt ist die Gründung einer Aktiengesellschaft, an der neben neuen Partnern die bisherigen elf Erzo-Gemeinden beteiligt sind. Bräuchte es dazu überall Gemeinderatsbeschlüsse?
Hier ist die Ausgangslage besonders knifflig. Zwar tritt die Erzo gegen aussen als Verband auf, dem elf Gemeinden angehören. Faktisch besteht das Konstrukt aber aus drei Teilen, an denen jeweils unterschiedliche Gemeinden beteiligt sind. Bei der Abwasserreinigung sind es sechs, bei der Kadaververwertung neun und bei der Kehrichtverbrennung elf Gemeinden. Im Zuge des Enphor-Projekts will die Erzo den Verband splitten, konkret in einen Abwasserreinigungs- und einen Kehrichtverwertungsverband. Die saubere organisatorische Aufteilung ist die Voraussetzung, um beim Bau und Betrieb einer neuen KVA strategische Partner ins Boot holen zu können. Hier gibt es grundsätzlich zwei Varianten. Variante A: Der Kehrichtverband transformiert sich in eine AG, an der sich Partner beteiligen können. Variante B: Es wird eine AG gegründet, an der sich der Verband Aktienanteile sichert. In der Variante A bräuchte es die einhellige Zustimmung aller Gemeinden – faktisch also elf positive Beschlüsse von elf Gemeindeversammlungen. Sagt nur eine Gemeinde nein, ist Enphor gescheitert. Bei der Variante B bräuchte es die Zustimmung der Erzo-Abgeordnetenversammlung. Allerdings hätte auch hier das Volk das letzte Wort. Gegen einen solchen Entscheid könnte in den elf Verbandsgemeinden das Referendum gestartet werden – dazu wären 3000 Unterschriften nötig. Das Projekt Enphor käme damit an die Urne.
5 Gibt es die Möglichkeit, dass sich Gemeinden beteiligen, die heute noch nicht Erzo-Mitglieder sind?
Falls eine AG gegründet wird, wäre eine Beteiligung anderer Gemeinden möglich, steht aber nicht im Vordergrund, wie Bruno Aecherli sagt. Eher unwahrscheinlich ist, dass heutige Verbandsgemeinden austreten, denn die Erzo hat sich als eine Art Schicksalsgemeinschaft formiert. Gemeinden könnten theoretisch der Erzo den Rücken kehren, sie hätten aber nur Nachteile. Sie würden nichts vom Vermögen (zurzeit rund 50 Millionen Franken) erhalten, würden aber weiter für den Verband haften – Voraussetzungen, die einen Austritt quasi verunmöglichen.
6 Gibt es einen ganz groben Zeitplan, bis wann das Projekt fertig umgesetzt sein könnte?
Enphor besteht aus verschiedenen Teilen, die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm ist einer davon. Hier gibt es eine Deadline: Das Gesetz schreibt vor, dass dies bis 2026 umgesetzt sein muss – will die Erzo in diesem Bereich erfolgreich werden, muss die Produktion also spätestens 2026 starten. Das ist realistisch, ein bewilligungsfähiges Bauprojekt könnte bis Mitte 2023 vorliegen. Ein Bauprojekt für die neue Energiezentrale hingegen – also eine neue KVA – könnte bis Ende 2024 vorliegen; den Betrieb aufnehmen könnte diese ab etwa 2030. Bis zum Jahr 2030 sollte es auch möglich sein, ein neues Fernwärmenetz oder zumindest grosse Teile davon zu bauen. Vier regionale Energiedienstleister sind in das Projekt integriert.
7 Ein Kritikpunkt lautet: Es ist nicht Aufgabe der Gemeinden, unternehmerisch tätig zu werden. Sie müssen den Güsel entsorgen und das Abwasser reinigen. Was sagt der Erzo-Vorstand dazu?
An der Abgeordnetenversammlung im Juni kritisierten einige Gemeindevertreter die ehrgeizigen Pläne des Erzo-Vorstandes. Enphor sei eine Schuhnummer zu gross, hiess es etwa. Es sei nicht Aufgabe der Gemeinden, unternehmerisch tätig zu werden – und damit auch entsprechende Risiken einzugehen. Erzo-Vize Bruno Aecherli verweist in diesem Zusammenhang auf ein vor drei Jahren verabschiedetes Strategiepapier. Darin ist in der Tat eine unternehmerische Grundhaltung formuliert. Die Rede ist etwa von effizienten Reaktionen auf Veränderungen im Markt – oder davon, dass «zur Sicherung der Marktposition Kooperationen aktiv angegangen und umgesetzt werden». Zudem hätten die Gemeinden der regionalen Energieplanung zugestimmt – mit «dem Versprechen, dass die Region bis 2050 hundert Prozent erneuerbare und CO2-freie Energie produzieren wird», wie Aecherli sagt. «Das Projekt Enphor trägt dazu bei, diese Ziele umzusetzen; es bietet Chancen und wenig Risiken.»
Serie
Im Juni hat der Vorstand des regionalen Entsorgungsverbandes Erzo die Pläne für das Projekt Enphor vorgestellt. Bis zu 400 Millionen Franken könnte der Bau einer neuen Kehrichtverwertungs- und Phosphorrecyclinganlage sowie eines Fernwärmenetzes kosten. Was sind die Hintergründe des Mega-Projekts? Wie könnte eine neue KVA aussehen? Wie geht es weiter? Das ZT beleuchtet in dieser Serie die Facetten von Enphor.