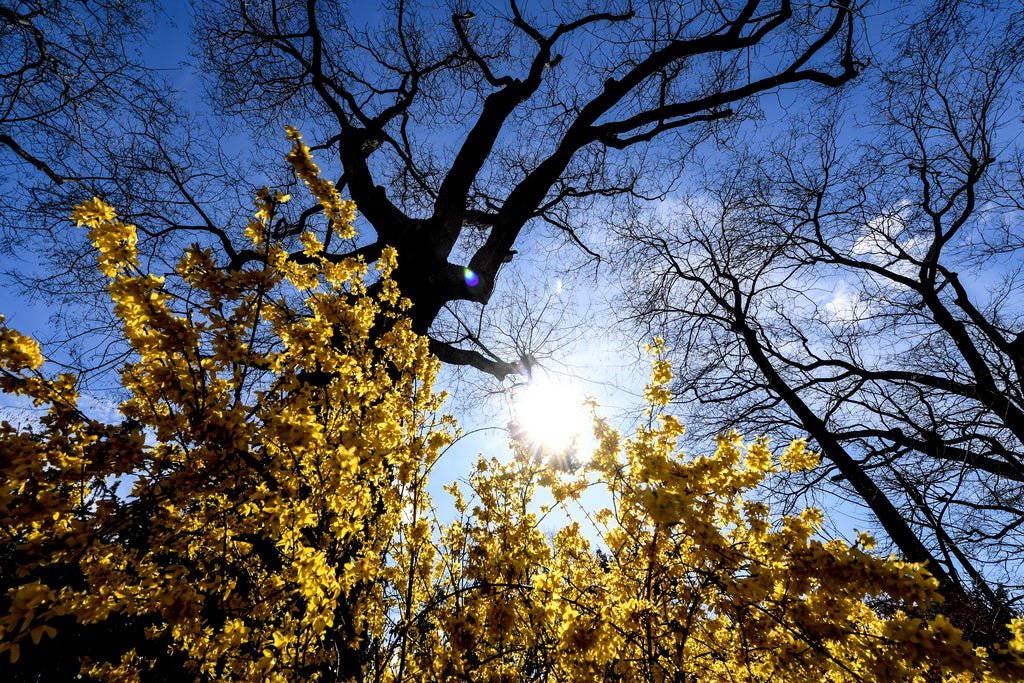
Das Virus zu Wasser, zu Land, in der Luft – und in Schulen: Was wir aktuell über Corona wissen
Mehr als zwei Monate sind vergangen, seit am 25. Februar im Kanton Tessin der erste Schweizer Coronafall identifiziert wurde. Seither kommen nicht nur täglich neue Fälle hinzu – sondern auch Wissen. Für einige Fragen, die damals völlig offen waren, gibt es inzwischen Anhaltspunkte – wenn auch noch keine Sicherheit. Eine Auswahl.
Auch im Abwasser sind Coronaviren: Das kann man nutzen
Forscher des Wasserforschungsinstituts Eawag können kleinste Konzentrationen des Coronavirus im Abwasser nachweisen. Gelungen ist das bereits in Lugano, Lausanne und Zürich. Die Methode zeigte schon Signale, als es in Lugano erst einen bekannten Fall gab und in Zürich sechs.
Gezeigt wird dabei nicht die Anzahl der Infizierten, sondern der Verlauf der Epidemie – auch rückwirkend, weil bei der Eawag Abwasserproben eingefroren gelagert sind. Hauptziel ist die Errichtung eines Frühwarnsystems. Mit Proben aus zwanzig grossen Kläranlagen in der Schweiz kann das Abwasser von 2,5 Millionen Menschen überwacht werden. So kann gemäss den Forschern beim Ausstieg aus dem Lockdown ein allfälliger Wiederanstieg schneller erkannt werden als mit klinischen Tests. Die Methodik muss allerdings weiter optimiert werden.
Malariamedikament Chloroquin ist gefährlicher als gedacht
Seit letzter Woche warnt die Schweizer Arzneimittelbehörde vor dem Einsatz von Hydroxychloroquin und Chloroquin. Die Malariamedikamente waren weltweit als Heilmittel gegen Coronaerkrankungen angepriesen worden. Nun gibt es Erkenntnisse, dass die Wirkstoffe bei den Erkrankten schwere Herzrhythmusstörungen verursachen können, die manchmal tödlich verlaufen.
Höhepunkt der Todesfälle überschritten
Der vorläufige Höhepunkt der täglichen Todesfälle war weltweit gesehen mit über 9000 Toten der 18. April. Die Zahl der bestätigten Fälle sinkt aber laut der Wissenschaftsplattform «Our World in Data» noch nicht und bewegt sich seit dem 6. April um täglich 80’000 herum. Begleiten wird das Virus die Menschheit noch länger und auch eine zweite Welle wird befürchtet.
Aber keine Pandemie dauert ewig. Wie hartnäckig das neue Coronavirus ist, wird sich zeigen – und ob ihm vorher eine Impfung den Garaus macht. Die Herdenimmunität – welche die Pandemie auch stoppen würde – ist jedenfalls in weite Ferne gerückt. Dies nicht nur, weil die Ansteckungsrate in der Schweiz inzwischen zum Glück unter 1 gesunken ist, sondern auch, weil unsicher ist, wie lange eine Immunität anhält. Immerhin könnte man für eine erneute Infektion durch das Coronavirus oder eine Mutation davon besser gewappnet sein. Fraglich ist, ob Personen mit nur milden Symptomen auch eine Immunität entwickeln.
Warum Männer häufiger an Covid-19 sterben als Frauen
Auch an Sars oder Mers starben mehr Männer als Frauen. Das Immunsystem von Frauen reagiert schneller und effizienter auf Infektionserreger. Dafür gibt es zwei Erklärungsansätze: zum Ersten die unterschiedlichen Sexualhormone. In weiblichen Körpern wird mehr Östrogen produziert, in männlichen mehr Testosteron. Während Östrogen das Immunsystem stimuliert, unterdrückt Testosteron es eher.
Die andere Erklärung hat mit dem Zellkern zu tun und den beiden X-Chromosomen der Frauen, die für die Regulation des Immunsystems wichtig sind. Eine andere Möglichkeit wäre der grössere Anteil an Rauchern unter den Männern. Eine abschliessende Antwort gibt es noch nicht.
Viren schweben auch in der Atemluft
Erste Studien weisen darauf hin, dass nicht Tröpfchen beim Husten voller Viren sind, sondern auch die blosse Atemluft in sogenannten Aerosolen Viren beinhaltet. Diese überleben in der Luft bis zu drei Stunden. Hält sich ein Kranker länger in einem Raum auf, steigt die Viren-Konzentration. Unklar ist, wie hoch sie sein muss, um sich mit solchen Aerosolen anzustecken. Die Konzentration der Viren draussen ist unbedenklich, sofern man den Abstand von zwei Metern einhält und nicht gerade hinter einem keuchenden Jogger herrennt.
Der Einfluss der Luftverschmutzung
Studien weisen darauf hin, dass in Regionen mit stark verschmutzter Luft mehr Menschen an Covid-19 sterben als an Orten, wo weniger Feinstaub und Stickoxide eingeatmet wird. Stickstoffdioxid greift die Atemwege an, kann Entzündungen oder Asthma auslösen. Entsprechend plausibel erscheint es, dass dort die Menschen vorbelastet und somit anfälliger für einen schweren Covid-19-Verlauf sind. Eine Preprint-Studie der Harvard University legt nun nahe, dass bereits geringe Unterschiede der Luftschadstoffe Auswirkungen auf die Todesrate haben sollen.
Keine Viren-Ausbrüche in schwedischen Schulen
Die Erfahrungen in Schweden, wo Kindergärten und Primarschulen nie geschlossen waren, zeigen, dass es über die Kinder nicht zu einer Ausbreitung der Ansteckungen kam. «Wir sehen keine Ausbrüche im Umfeld der Schulen», erklärte Anders Tegnell, Chefepidemiologe der Gesundheitsbehörde letzte Woche.
Dies gilt für Schüler- und Lehrerschaft: «Bei den wenigen Fällen, wo es eine Ansteckung unter Erwachsenen gab, war klar, dass Lehrerkollegen einander infiziert haben», so Tegnell. Coronastudien mit Kindern wurden bisher in Schweden nicht gemacht; dafür fehlt es an Testkapazität. Das Land hatte von Anfang an die Position vertreten, dass Schulschliessungen soziale Probleme auslösen können.





