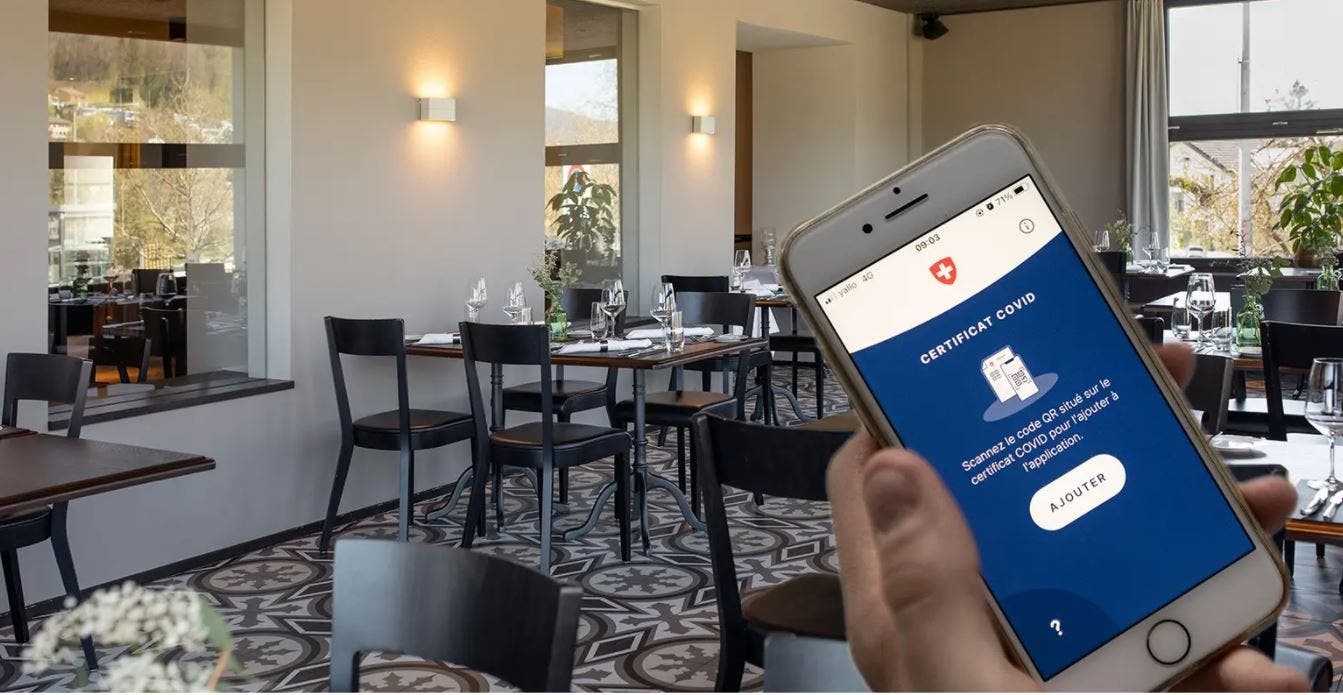Die Krankenkassenprämien nach Corona
Dass die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft in eine Krise geführt hat und in den nächsten Monaten – und hoffentlich nicht für die nächsten Jahre – in eine Rezession reisst, ist unbestritten. Deshalb geht nicht nur die Angst vor dem Corona-Virus um, sondern auch vor Arbeitsplatzverlust.
Bisher kaum thematisiert wurden die Auswirkungen der Corona-Krise auf unsere Gesundheitskosten – und unsere künftigen Krankenkassenprämien. Linke, aber auch bürgerliche Politikerinnen und Politiker warnten nun aber im «Blick» vor einem «Prämienschock». Ist dem so? Nein – solange das geltende Krankenkassenversicherungsgesetz (KVG) nicht per Notrecht ausser Kraft gesetzt wird.
Basis für die Berechnung der Prämien 2021 sind laut KVG nicht die Kosten, die 2020 anfallen, sondern eine Prognose der Ausgaben im Jahr 2021. Selbst wenn die für 2020 eingenommenen Prämien die Kosten der Pandemie nicht decken, können die nicht so einfach auf die Prämien des Folgejahres durchschlagen: die Kassen haben nicht ganz freiwillig Reserven. Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) betrugen diese zu Beginn des Jahres 2019 9,5 Milliarden Franken – doppelt so viel, wie rechtlich vorgegeben wäre.
Die Konjunkturforschungsstelle der ETH geht davon aus, dass die Gesamtausgaben der Grundversicherung für das Jahr 2020 unter normalen Umständen etwa 33 Milliarden Franken betragen hätten. Entsprechend müsste die Pandemie die Kosten um rund 30 Prozent nach oben katapultieren, damit die Reserven aufgebraucht würden.
Was Corona hingegen dauerhaft verändern könnte, ist das Thema der «Vorratshaltung» – bei Spitalbetten und Medikamenten. In St. Gallen hätte das Kantonsparlament in diesen Wochen die Stilllegung von fünf Spitälern beschliessen sollen. Vor dem Hintergrund von Corona wurde dieser Entscheid vertagt. Er wird zum Lackmus-Test, ob die Politik weiterhin die Spitallandschaft neugestalten und da und dort Betten zugunsten des Prinzips ambulant vor stationär aufheben will – oder künftig auf eine Betten-Reserve baut.
Medikamente. Hier drängen Gesundheitspolitikerinnen und -politiker (unter ihnen die Aargauer CVP-Nationalrätin Ruth Humbel) die Produktion von Medikamenten zurück in die Schweiz zu holen – und nicht mehr auf den tiefsten Preis zu schauen. Versorgungssicherheit hat ihren Preis.
Den wollen aber nicht alle voll bezahlen. Bereits geistert die Idee des «Tendersystems» durch die Köpfe. In Deutschland schreiben die Krankenkassen einen Wirkstoff aus und der Generikaanbieter mit dem tiefsten Preis darf alle Patienten der Kasse mit seinem Tender beliefern – eine freie Medikamentenwahl gibt es nicht mehr. Dieses System lässt wenig Platz für die Finanzierung der Pharmaforschung. Sie ist Teil des Medikamentenpreises.