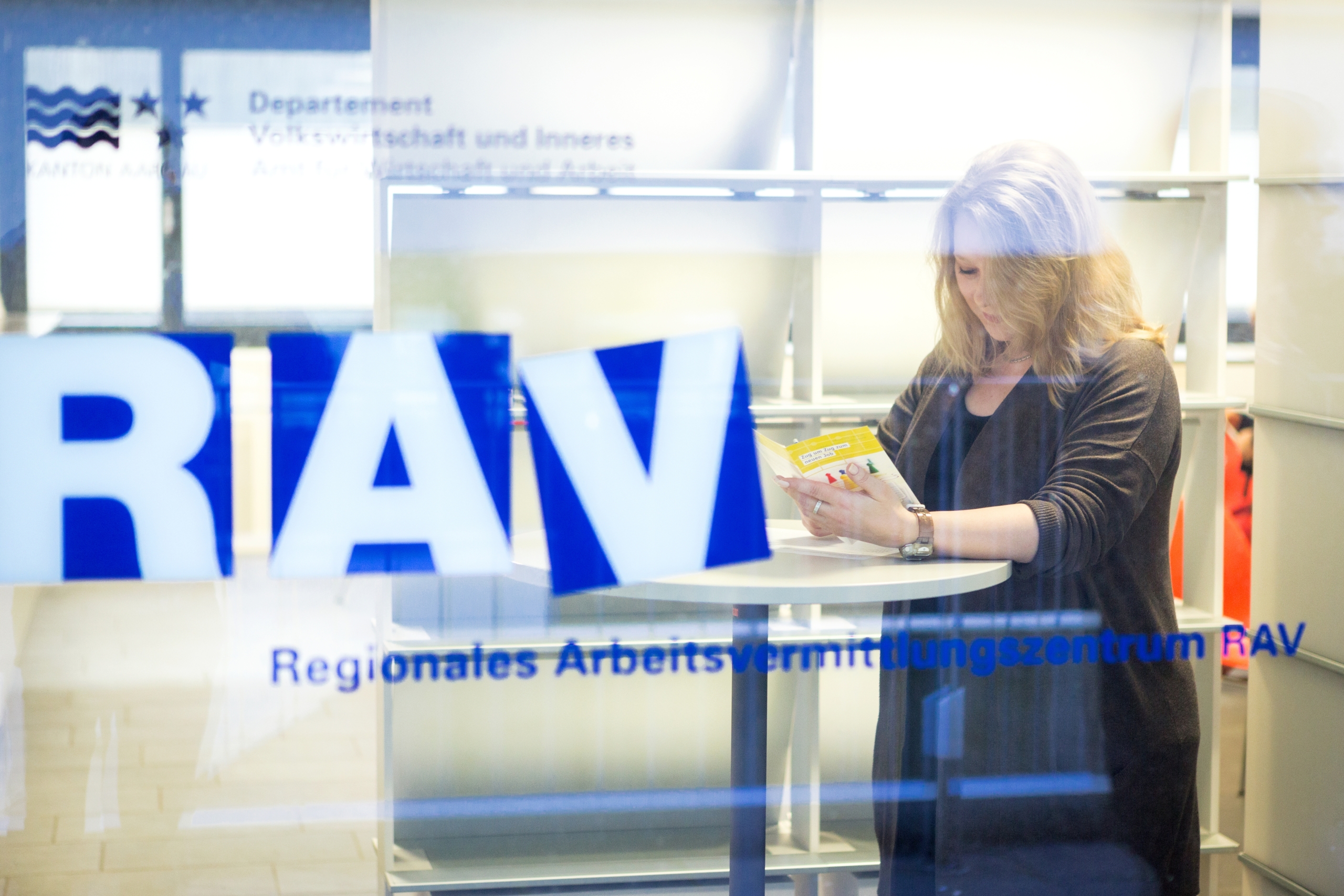Ein Leben für das Bier: Bruno Born braute 48 Jahre bei Feldschlösschen
Plötzlich blinkt die Warnleuchte im grossen Sudhaus der Brauerei Feldschlösschen, Feldschlösschenstrasse, Rheinfelden. Über der Steuerstation leuchtet eine orange Drehlampe. Bruno Born, seit drei Wochen pensioniert, posiert für den Fotografen zwischen den glänzend polierten Kupferkesseln. Als der Fotograf sich kurz umpositioniert, sagt Born: «Tschuldigung, aber jetzt muss ich mal schauen, was da los ist!»
Das Sudhaus war fast ein halbes Jahrhundert lang der Arbeitsplatz von Bruno Born, 65, Möhlin. Vor ein paar Tagen haben sie ihn verabschiedet. Die Unternehmenskommunikation schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: «Nach 48 Jahren bei Feldschlösschen geht unser Brauer Bruno Born in den wohlverdienten Ruhestand. Wir danken ihm sehr für seinen Dienst zu Ehren des Schweizer Bieres und überreichen ihm den Bierorden. Wir werden dich vermissen, Bruno!»
Von Hand schleppen
Als die Anfrage für das Porträt Bruno Born zu Hause erreicht, sagt er in den Telefonhörer: «Wir können uns schon treffen. Aber zuerst müssen Sie bei der Feldschlösschen fragen. Wenn die nicht einverstanden sind, geht es nicht.» Borns Generation gehört zu jenen, in denen Loyalität noch kein Schimpfwort, sondern ein Lob war.
Bei der Feldschlösschen ist man einverstanden. Im «Schalander», Personalrestaurant. Reporter und Bruno Born sitzen auf Holzstühlen mit geschnitztem Feldschlösschen als Rückenlehne. Bruno Born, schwarze Jeans, schwarz-grauer Baumwollpullover, fingerbreite Aufschrift «high tech», sagt: «Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir die schweren Säcke voller Braugerste von Hand geschleppt haben.» Ja, der Brauprozess habe sich schon verändert. Am Anfang sei es viel Handarbeit gewesen. Zutaten beigeben, Wasser- und Dampfhähne bedienen, Gefässe putzen. Später wurde automatisiert. «Wir wollten ja den Fortschritt nicht verpassen», sagt Bruno Born, und in seinem Blick liegt neben der Erinnerung an die kraftaufwendige Büez auch ein wenig Sehnsucht nach ihrer Einfachheit. Er erinnert sich: «Die Computer haben uns schlaflose Nächte bereitet.» Mit seinem Abteilungsleiter habe er den Kurs besuchen müssen. «Ich hatte Bauchweh. Aber als wir mit den Bürolisten so in einer Reihe sassen und die genauso ratlos waren wie wir Brauer, waren wir froh.»
Das Bierbrauen habe man deswegen nicht neu erfinden müssen, sagt Bruno Born im Rückblick. Was sich aber nebst der Technik stetig verändere, seien die Rohstoffe. «Bei der Gerste gibt es auch gute oder schlechte Jahrgänge. Was beim Wein geschätzt und im Idealfall sogar gelobt wird, wird beim Bier nicht akzeptiert.» Um die Qualität stabil zu halten, mische man verschiedene Malz- und Hopfenlieferungen – immer sortenrein – zusammen. «Wenn einmal die französische Ernte verregnet wird, können wir das mit der deutschen Ernte, die viel Sonne hatte, ausgleichen», erklärt Born.
Keine Widerrede
Es war Anfang der 70er-Jahre, als Vater Born, bei Feldschlösschen als Buffetmaler angestellt, seinen Buben Bruno mitnahm. Die Aargauer Brauerei war damals schon ein Grossbetrieb. Bruno durfte sich alle Berufe genauer anschauen: Mechaniker, Küfer, Schreiner – Maler, Sattler, Maurer – Elektriker, Fahrer, Brauer. «Diese Vielseitigkeit hat mir schampar imponiert. Und auch diese Gebäude! Noch heute friert es mich, wenn ich hier in die Einfahrt einbiege.» Vater Born hätte Bruno gerne als direkten Erbfolger in der Buffetmalerei installiert. «Doch das Brauen hat mich von Anfang an gepackt. Obwohl Biertrinken auch zu jener Zeit in dem Alter noch überhaupt kein Thema war.» Ein langes Bewerbungsverfahren gab es nicht: «Man hat einfach miteinander geredet.» Bruno Born trat bei Feldschlösschen ein – und blieb. Über 48 Jahre lang. Nur einmal musste er weg. Der Chef wollte es so, «und wenn der Chef etwas sagte, gab es keine Widerrede.» Nach zweieinhalb Jahren war seine Ausbildung als Brauer in Rheinfelden abgeschlossen, doch es fehlte noch ein halbes Jahr in der Mälzerei. Den Vertrag in Basel für die Zusatzausbildung hatte er auf sicher, aber in Basel hatte man grad keinen Platz. Bruno Born wurde in die Ostschweiz geschickt, St. Gallen-Bruggen, Stocken-Bräu. «Ich hatte zwar Heimweh. Aber eigentlich gefiel es mir gut. In dieser Kleinbrauerei war vieles anders. Und wenn ich den Vertrag in Basel nicht schon in der Tasche gehabt hätte, wäre ich vielleicht sogar geblieben.»
Noch nicht gelandet
Heute sagt Bruno Born: «Ich bin froh, dass ich noch gesund bin.» Jahrzehntelang hat er im Dreischichtbetrieb gebraut. Morgen-, Nachmittags-, Abendschicht. Wöchentlich wechselnd. «Am liebsten hatte ich immer die Morgenschicht. Ich bin ein Frühaufsteher.» Sie startete erst um 4.30 Uhr, später wurde der Beginn auf 5 Uhr gelegt. Die Schichtarbeit habe viele Vorteile gehabt, er habe viel Zeit mit der Familie, mit den zwei Töchtern verbringen können. Töfffahren, Fotografieren, Bogenschiessen.
Aber nicht nur. «Wenn sie mich gefragt haben, habe ich eigentlich nie Nein gesagt», erzählt Bruno Born. So sass er jahrelang in der Betriebskommission. Das brachte ihm wiederum den Nebenjob als Richter am Arbeitsgericht des Bezirksgerichts Rheinfelden ein.
Was er jetzt mit der neu gewonnenen Freizeit den ganzen Tag lang anstellt, weiss er noch nicht. «Ich bin die dritte Woche daheim. Ich fühle mich immer noch, als hätte ich Ferien. Oft meine ich, es sei Samstag, weil ich nicht in die Firma muss.» In seiner Gefühlswelt sei die Pensionierung «noch nicht gelandet».
Wie wäre es mit einer Heimbrauanlage? Endlich das Bier brauen, das er sich insgeheim immer gewünscht hätte? Bruno Born winkt entschieden ab: «Da hab ich also gar keine Ambitionen.» Wenn er ein gutes Bier wolle, komme er hierher. Oder er kehre in Möhlin in den «Sonnenberg» ein. Das «Original», das Lager von Feldschlösschen, sei sein Liebstes. «Vielleicht zwischendurch mal eine Hopfenperle. Aber die Spezialbiere überlasse ich gerne anderen.» Er sei ohnehin kein Stammtischhocker. Eher kehre er auf einem Ausflug einmal ein. «In der Regel schon in eine Feldschlössli-Beiz.»
Fast wie ein König
Am letzten Arbeitstag wurde Bruno Born eine besondere Ehre zuteil: Er erhielt den Bierorden des Schweizer Brauerei-Verbands. Der Feldschlösschen-CEO war im Ausland, unverschiebbare Sitzung, schickte aber eine Videobotschaft. «Ich kam mir fast vor wie ein König!», erzählt Born. Das Esszimmer zu Hause trage den Namen «Bierstübli», Steinkrüge von Schweizer Brauereien, selbst gebaute Lampe aus Bierflaschen. «Dort erhält der Orden einen schönen Platz.» Der Brauerei-Verband und die angeschlossenen Brauereien ehren damit Personen, die sich um die Förderung des Bieres oder dessen Tradition besonders verdient gemacht haben. «Scheinbar gibt es Leute, die finden, das habe ich», sagt Bruno Born. Er schaut durchs Fenster leicht wehmütig zum Sudhaus hinüber.
Von «Biberbräu» bis zu «Malz Maul»
Im Kanton Aargau gibt es derzeit total 71 registrierte Brauereien (Stand Ende März 2018). Das zeigt der Blick ins «Verzeichnis der steuerpflichtigen Inlandbrauereien» der Eidgenössischen Zollverwaltung. Die bekanntesten neben Feldschlösschen sind die Brauerei H. Müller AG in Baden («Müller Bräu») sowie die LägereBräu AG in Wettingen. Der Trend, dass immer mehr Bierliebhaber ihre eigenen Kreationen herstellen wollen, hält an. Waren es landesweit im Jahr 2000 noch 81 gemeldete Brauereien, stieg diese Zahl bis ins Jahr 2016 auf knapp 700 an. Heute sind es bereits 921. Der Herkunft verbunden Man sieht es vom Städtchen, vom Zug und von der Autobahn aus: Das Feldschlösschen, das Wahrzeichen des bekanntesten Schweizer Biers. Jede vierte in der Schweiz getrunkene Stange stammt von dieser Marke. Der Unternehmensname (1876) ist zwar einige Jahre älter als das Produktionsgebäude im damals in der Industriearchitektur angesagten Burgenstil (ab 1882). Doch Name und Bau sind untrennbar verbunden und bilden ein sinnvolles Gespann. Das ist auch bei vielen anderen Aargauer Brauereien der Fall. Besonders beliebt sind Namenskombinationen, die auf den geografischen Ursprung hinweisen. So hat man in Biberstein die eigene Kreation «Biberbräu» getauft, in Besenbüren «Bäsi-Bräu» oder in Lenzburg «Aabach-Bier». Ebenfalls auf die Herkunft schliessen lassen die Namen «Künter Stallbräu» (Künten), «Schümberg-Bräu» (Ittenthal) oder «Reuss-schlaufenbier» (Bremgarten). Engel, Madl und Magie Neben den Betrieben, die ihr Bier nach der Herkunft benennen, und vielen Herstellern, die auf den Familiennamen setzen, gibt es auch zahlreiche Brauer, die bei der Namensfindung für ihr Bier mehr oder weniger Kreativität walten gelassen haben. In Untersiggenthal kennt man das «Knuddelbräu», in Villnachern das «Magie-Bräu» und in Schneisingen das «Madl-Bräu». Das «Kurvenbier» wurde in Künten erfunden, das «Ängelbräu» in Schupfart und in Frick das «Reinecke-Bräu» Will man eine Aargauer Bierauswahl in der richtigen Abfolge trinken, empfiehlt sich folgendes Menü: Man beginne mit einem Produkt der Brauerei Schlugg (Rheinfelden), fahre mit einem «Torkelbräu» (Niederlenz) fort und ende beim «Malz Maul» (Turgi). Dann ist definitiv «Fyrabig» (Riniken).