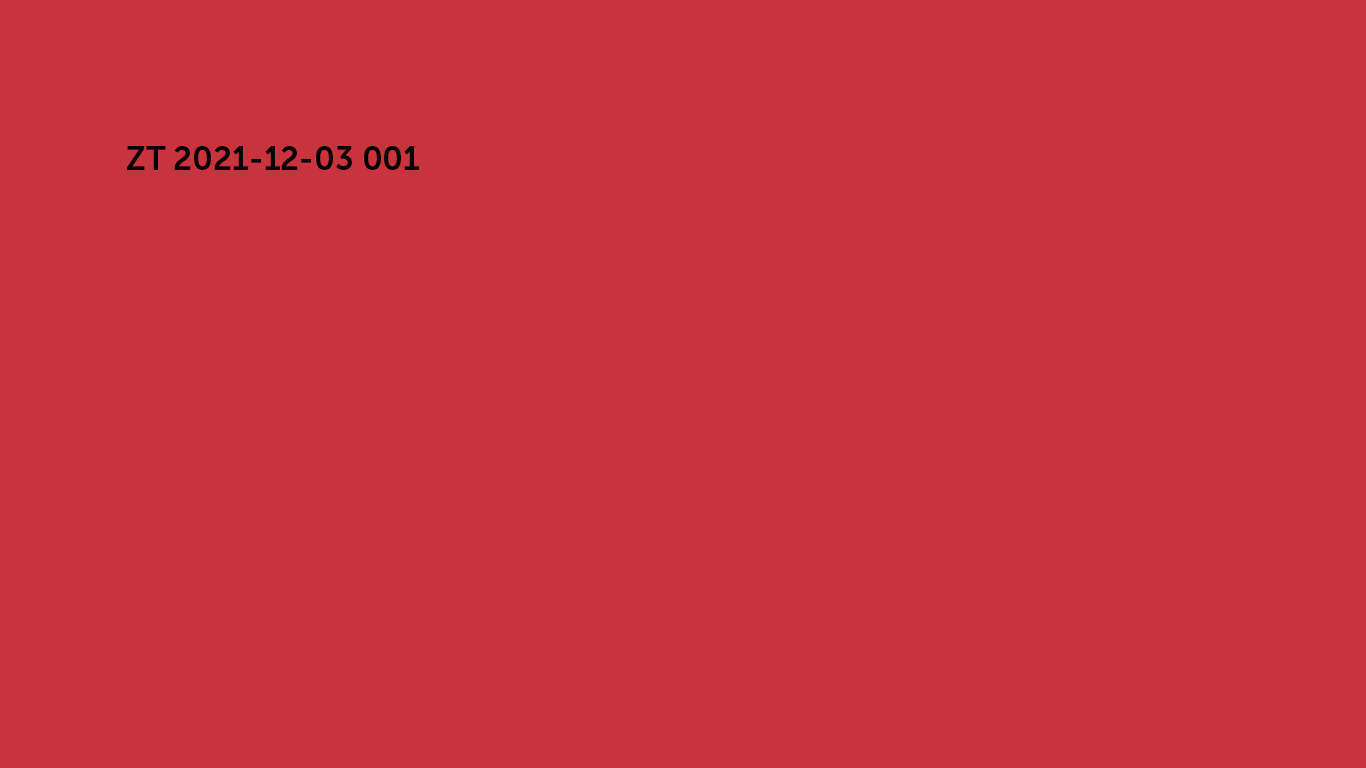Ein Ort, an dem sich die Trauer von ihrer schönen Seite zeigt
In der heutigen Gesellschaft, in der in den sozialen Medien alles und jeder perfekt ist, erhalten schwere Fragen selten einen grossen Platz. Obwohl Themen wie das Sterben und der Tod bei weitem nicht gleich viel Laune machen wie die letzten Sommerferien oder ein aktueller Kinofilm, ist es doch wichtig, dass wir sie nicht an den Rand schieben.
Weil die Menschen heute älter werden und die Pflege vermehrt wieder zu Hause stattfindet, hat das Sterben und der Tod wieder Einzug ins private Wohnzimmer gehalten. Die Palliativbewegung, die sich in den 1960er Jahren in der Schweiz etabliert hat, unterstützt diesen Trend (siehe Box). Auch das Trauer Café in Reiden bietet den Angehörigen die Möglichkeit, den Tod in ihr Leben zu integrieren. Bitte, treten Sie ein.
Das Eintreffen
Im Januar 2015 wurde das Trauer Café in Reiden zum ersten Mal durchgeführt. Seither trifft man sich viermal jährlich in den Büroräumlichkeiten der Spitex Wiggertal in Reiden. Das Trauer Café ist Teil des Palliativkonzepts. Ohne Anmeldung und kostenlos können sich Interessierte ins Café setzen. Das Angebot steht auch denjenigen Leuten offen, die keinen Bezug zur Spitex Wiggertal haben. Im Schnitt besuchen bis sechs Personen das Trauer Café. Dies geschieht in der Regel erst ein paar Wochen oder Monate nach dem Tod des Angehörigen. Kurz nach dem Verlust gibt es viel zu organisieren und man hat gar keine Zeit, den Kummer zuzulassen. Erst, wenn Ruhe einkehrt, holt einen der Schmerz ein. Doch Regeln und Rezepte gibt es beim Trauern nicht. Jeder Mensch trauert so individuell wie er selbst ist.
Das Vorstellen
Agnes Bossert, Marie-Theres Habermacher und Sabrina Aecherli erwarten die Besucherinnen und Besucher bereits. Sie eröffnen das Trauer Café und stellen die wichtigsten Regeln vor: gegenseitiger Respekt, keine Wertungen und nichts, was im Trauer Café beredet wird, dringt nach aussen. Danach kommt es zur Vorstellungsrunde.
Agnes Bossert ist 63 Jahre alt und hat ursprünglich eine Lehre als Köchin absolviert. Mit 48 Jahren ist sie ihre eigene Trauerbewältigung angegangen und seit längerem begleitet sie Menschen im Sterben. In den Jahren 2007 und 2008 hat sie sich entschieden, den Lehrgang zur Trauerbegleiterin zu absolvieren. «Ich habe gemerkt, dass bei der Sterbebegleitung der Sterbende im Zentrum steht, gleichzeitig die Angehörigen sich in ihrer Trauer oft allein gelassen fühlen», sagt die Initiantin des Trauer Cafés. Heute hat sie eine eigene Praxis in Langnau, in der sie Einzelgespräche für Trauernde anbietet.
Seit 2018 hilft auch Marie-Theres Habermacher bei der Durchführung des Trauer Cafés mit. Sie ist freischaffende Psychologin und Psychotherapeutin, 66 Jahre alt und hat sich in den letzten Jahren auf die Bereiche Sterben, Tod und Trauer fokussiert. Ausserdem hat sie den Lehrgang Spiritual Care besucht. Der Verlust der Mutter sowie zweier Freundinnen mit Krebserkrankung innerhalb eines Jahres zeigte ihr, dass Angehörige und Freunde in ihrer Trauer Gefässe brauchen. Auch sie führt eine eigene Praxis in Richenthal und hilft mit beim Aufbau des Hospiz Zentralschweiz.
Die Jüngste im Trio ist Sabrina Aecherli. Die Pflegefachfrau ist Palliativverantwortliche bei der Spitex Wiggertal und absolviert zurzeit den Master in der Palliativ Care. Davor hat sie im Kantonsspital Luzern gearbeitet. Doch sie hat gemerkt, dass sie zu wenig Zeit für die Patienten und ihre Angehörigen aufwenden konnte. Die 38-Jährige hat bereits als kleines Mädchen ihre Grossmutter, ihren Grossvater und ihre Grosstante auf dem Sterbebett begleitet. Ihre jetzige Arbeit sieht sie als komplett: «Von der Diagnose über die Palliativpflege bis hin zur Trauerbegleitung: genau mit einer solchen Philosophie sollte man überall arbeiten.»
Dann ist da noch eine andere Frau im Café. Lisa Bättig*, eine Trauernde. Sie war eine der ersten im Trauer Café. Als sie ihren Mann verlor, suchte sie erst nach einem Jahr das Café auf. Vorher hat sie sich mit administrativen Aufgaben und dem Alltag abgelenkt. Als die Trauer drohte, sie zu übermannen, erholte sie sich in einem Kurhaus, wo sie viele Einzelgespräche mit Fachpersonen führte. «Danach war ich gesättigt von Einzelgesprächen. Trotzdem musste ich dranbleiben. Das Trauer Café war eine gute Lösung», schildert sie ihre Beweggründe. Ausserdem hat sie Agnes Bossert bereits zu Lebzeiten ihres Mannes kennengelernt. «Zwischen Agnes und mir hat es bereits damals eine gute Verbindung gegeben. Beim Abschlussgespräch hat sie mich dann auf das Café aufmerksam gemacht. So wurde mir der Einstieg sehr erleichtert», erzählt die Witwe.
Der Einstiegsgedanke
Spiritualität gehört fest zum Trauerprozess. Obwohl das Café überkonfessionell ist, bedient es sich häufig an spirituellen Gedanken und Fragen. Nach der Vorstellungsrunde eröffnet eine der zwei Trauerbegleiterinnen mit einem Leitspruch das Gespräch und gibt damit eine erste Stossrichtung an, an der sich die Besucherinnen und Besucher orientieren können.
Das Gespräch
Die Themen sind divers, befinden sich die Besucherinnen und Besucher doch häufig in den unterschiedlichsten Trauerphasen. Es wird geweint, erzählt, gemeinsam gelacht oder einfach geschwiegen. Alles hat seinen Platz. «Es gab skurrile Situationen, in denen eine andere Besucherin von sich erzählt hat und ich mich darin wiedererkannte. Dann haben wir gemeinsam darüber gelacht», erinnert sich die Trauernde. Auch das gemeinsame Schweigen gehöre dazu. «Manchmal gibt es einfach nichts mehr zu sagen, und das ist dann auch in Ordnung», meint Agnes Bossert.
Lachen, weinen, leben, sterben: Für Marie-Theres Habermacher sind das keine Gegensätze, ganz im Gegenteil: «Wir trauern nicht nur, wenn jemand stirbt. Trauern kann man auch, wenn man pensioniert wird oder umzieht. Bereits das Leben hat viele kleine Trauerprozesse integriert, die uns für das grosse Trauern am Schluss vorbereiten.» Auch Lisa Bättig hat früh damit angefangen: «Die Diagnose meines Mannes war eine Chance, mit dem Trauern schon sehr früh zu beginnen. Wir mussten täglich Abschied nehmen.»
Es geht häufig auch um die Frage, was nach dem Tod kommt. Die drei Frauen sind sich einig: Der Tod ist nicht das Ende. «Über die Sterbebegleitung habe ich die Überzeugung erhalten, dass es nach dem Tod weitergeht. Wenn ich dabei bin, wenn jemand geht, ist es für mich so klar, dass es danach weitergehen muss. Das Leuchten und die Stimmung, die im Raum sind, das kann nicht fertig sein», schildert Marie-Theres Habermacher ihre Erfahrungen. Agnes Bossert glaubt an eine allumfassende Liebe und ein Licht, die sie nach dem Tod empfangen werden. Auch Sabrina Aecherli zählt bei dieser Frage auf ihre Erfahrungen: «Wie Sterbende von Leuten erzählen, die nicht mehr da sind, zeigt mir, wie nahe sie ihnen irgendwie sein können.»
Das Thema
Es gibt Abende, an denen könnte das Gespräch scheinbar bis tief in die Nacht gehen. Und dann gibt es Treffen, in denen das Gespräch zu einem natürlichen Halt kommt. In diesem Moment stellt eine der Trauerbegleiterinnen das vorbereitete Thema vor, das sich oft an den Jahreszeiten orientiert. So geht es beim Thema «Frühling» um Verwandlung, die auch bei der Trauerbewältigung eine wichtige Rolle spielt. «Die Natur lehrt uns, dass alles miteinander Hand in Hand geht und dass sich alles immer wieder wiederholt. Geburt, Leben, Tod. Deshalb passt das auch so gut als Thema», erklärt Agnes Bossert. Aber auch mit Themen wie «Licht» haben sich die Cafébesucher bereits auseinandergesetzt. Das Licht, das im Winter ziemlich reduziert ist und die langen Abenden doppelt schwierig macht, weil man die Lücke bewusster wahrnimmt. Wichtig ist, dass nach dem Thema alle für sich eine Idee mitnehmen können.
Kaffee und Kuchen
In der letzten halben Stunde des zweistündigen Treffens wird Kaffee und Kuchen serviert und die Gespräche öffnen sich, damit die Besucher mit anderen Gedanken nach Hause gehen. Es soll ein guter Abschluss mit dem Sterben und dem Tod für diesen Abend gefunden werden.
Doch was konnte das Trauer Café nun wirklich bei den Trauernden bewirken? «Nach jedem Besuch gehe ich zufrieden mit mir nach Hause», erzählt Lisa Bättig. Sie habe einen tollen Freundeskreis und fühle sich bei ihren Mitmenschen gut aufgehoben. «Mit der Zeit, als ich häufig Tiefs durchlebte, hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht mit mir stimmte und ich nicht mehr normal sei. Das Café zeigte mir aber auf: Es gehört dazu, es ist normal.» Die Gewissheit, dass manch irrationale Entscheidung und Handlung zum Trauern dazugehört, schenkt vielen Trauernden Trost. «Das Café ist ein Ort der Gleichgesinnten. Es sind Menschen hier, die den Schmerz verstehen und ähnliche, wenn nicht sogar die gleichen Erfahrungen gemacht haben», so Habermacher.
Auch die Angst, die beim Gedanken an den Tod häufig auftaucht, wird im Café thematisiert. Aus medizinischer Sicht kann vor allem Sabrina Aecherli als Pflegefachfrau Ängste abbauen: «Ich kann zum Beispiel erklären, wieso der Verstorbene kurz vor seinem Tod so seltsam geatmet hat und ob man noch etwas hätte tun können. Durch die Erklärungen wird die Angst kleiner und der Trauerprozess unterstützt», weiss Aecherli. Agnes Bossert geht noch einen Schritt weiter und erläutert die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit den eigenen Todesängsten: «Wenn man sich mit dem eigenen Tod auseinandersetzt und ihn nicht mehr verdrängt, schwindet die Angst, und man fängt an, erst richtig intensiv zu leben.»
Die Zeit danach
Das eigene Umfeld ist bei der Trauerbewältigung wie ein rettendes Fangnetz. «Zuhören ist dabei sehr wichtig. Aber auch aushalten zu können, sich das Gleiche mehrere Male anzuhören», rät Marie-Theres Habermacher. Häufig habe man als Angehöriger eines Trauernden das Gefühl, man müsse gleich etwas darauf antworten. Dabei sei es laut Habermacher einfach nur wichtig, präsent zu sein und Verständnis zu zeigen. «Wenn der Trauernde die Welt grau sieht, dann darf sie auch so grau sein. Man sollte nicht versuchen, die Welt in diesem Moment farbig zu machen.» Der Trauernde sollte ausserdem miteinbezogen und nicht bemuttert werden, rät Agnes Bossert. Man solle ihm nicht die ganze Arbeit abnehmen, sondern viel lieber erst mal nachfragen, ob das Bedürfnis überhaupt existiere. Und allenfalls auch mit einem Nein leben können. Nach Habermacher ist das Schlimmste jedoch, wenn das Umfeld dem Thema ausweicht: «Viele Gegenüber können nicht über den Tod und das Sterben reden und deshalb wechseln sie das Thema im Gespräch. Das ist für Trauernde das Schlimmste.» Wenn Lisa Bättig an ihre Trauerphasen denkt, muss sie lächeln: «Ich war zum Teil sehr schwierig. Je nach dem, in welcher Situation man einen Trauernden erwischt, kann man machen, was man will. Es ist nie richtig.»
Beim Trauern jedoch ist alles richtig. Frauen sprechen normalerweise lieber über ihr Leid als Männer, weshalb es bis jetzt auch meistens Frauen waren, die das Trauer Café besuchten. Männer verarbeiten ihre Emotionen häufiger bei Aktivitäten, wo Gespräche eher Nebensache sind. Auch Lisa Bättig passt gut in dieses Schema: «Für mich gehört Weinen zum Trauern, aber auch menschliche Nähe. Denn es verbindet einen nichts mehr als gemeinsamer Kummer, was wiederum der schöne Aspekt ist.» Den Schlüssel zur Trauerbewältigung hat sie bereits gefunden. «Man kommt nie darüber hinweg. Die Trauer gehört heute zu mir. Der Anspruch, dass das Leben danach gleich oder ähnlich weitergeht, ist nicht realistisch», so Bättig. Ausserdem verrät sie, wieso sie nicht will, dass der Schwermut vorbeigeht: «Wenn ich trauere, ist mein Mann sehr nahe bei mir, und das möchte ich nicht missen.» Gleich sieht es Psychotherapeutin Marie-Theres Habermacher: «Der Schlüssel ist, einzusehen, dass der tote Mensch auch weiterhin ein Teil von mir bleibt. Ich lerne, ihn zu integrieren, ohne dass er physisch präsent ist.»
Die Entwicklung der Palliative Care
Die Ursprünge liegen in den 1960er Jahren, als sich eine Gegenbewegung zur Apparatenmedizin formte. Lange Zeit konnte die Medizin nur wenige Krankheiten heilen und machte deshalb zu einem grossen Teil bereits das, was wir heute Palliative Care nennen. Sie versuchte, Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu erhöhen. Erst im Verlauf des letzten Jahrhunderts rückte mit dem medizinischen Fortschritt die kurative Versorgung mit lebenserhaltenden Massnahmen in den Vordergrund. Dadurch gelang es zwar, die Lebenserwartung vieler Menschen massiv zu verlängern, doch gleichzeitig zeigten sich bald grosse Defizite bei der Behandlung von Menschen am Lebensende. Bei der Palliativ Care wird statt Lebensverlängerung um jeden Preis eine möglichst hohe Lebensqualität angestrebt. Die Hospiz- und Palliativbewegung hat in den letzten Jahrzehnten weltweit dazu beigetragen, dass Menschen, bei denen das Lebensende absehbar ist, nicht alleine gelassen werden.