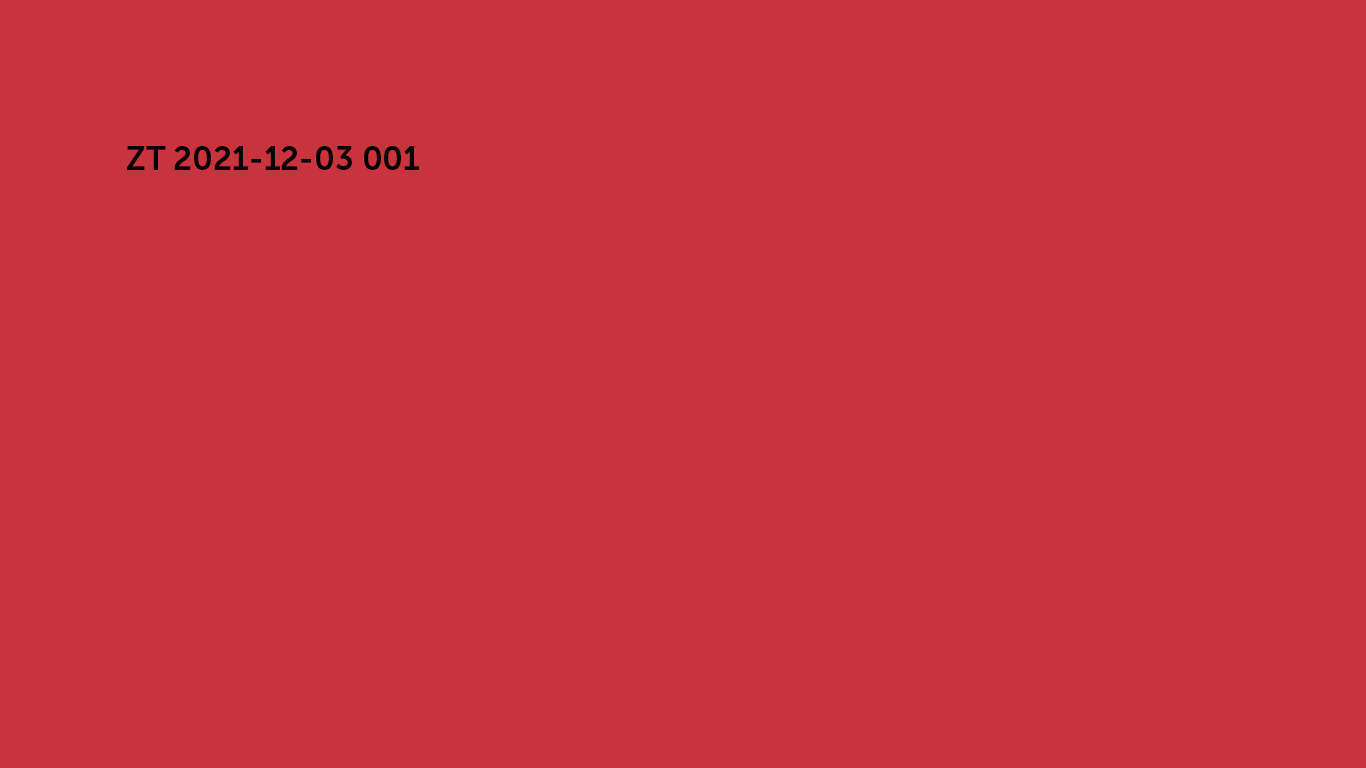Eine App gegen das Vergessen des Holocaust
73 Jahre ist es her – das Ende des Zweiten Weltkrieges. Menschen, die die Verbrechen der Nazis damals selber erlebt haben, also Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die aus erster Hand von den Verbrechen der Nazis berichten können, sind ein wichtiges Element der Geschichtsvermittlung. Doch sie sterben aus.
Deshalb hat die PH Luzern zusammen mit der Fachhochschule Vorarlberg und erinnern.at, dem Institut für Holocaust Education, eine Lern-App zum Thema entwickelt. Die Applikation «Fliehen vor dem Holocaust. Meine Begegnung mit Geflüchteten» kann auf Smartphones, Tablets und dem Desktop verwendet werden und ist gratis downloadbar. Zielgruppe sind 14- bis 18-Jährige. «Wir hoffen aber, dass sich auch ältere Geschichtsinteressierte damit auseinandersetzen», sagt Peter Gautschi, Leiter des Zentrums Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern. Es gebe keine Altersbeschränkung, keine schockierenden Bilder oder Texte.
Fünf Personenportraits
Inhalt der App sind Personenportraits. Da schildert beispielsweise Eva Koralnik (geboren 1936) wie sie als 8-Jährige aus Budapest in die Schweiz geflohen ist. Vier weitere Personen erzählen in 20 Minuten per Video von ihrer Flucht in die Schweiz, nach China und Palästina. Sie hätten aus pädagogischer Sicht bewusst Geschichten genommen, die positiv ausgingen, sagt der Zofinger Peter Gautschi. «Wir hätten gerade so gut auch eine App machen können mit fünf Menschen, die an der Schweizer Grenze abgewiesen und in den sicheren Tod geschickt wurden.»
Nach den Videos werden die Nutzerinnen und Nutzer aufgefordert, auf dem Zeitstrahl Ereignisse den korrekten Jahreszahlen zuzuordnen. Weiter wird man beispielsweise gefragt, was es für einen bedeutet, Angst zu haben. Die Lern-App biete die Möglichkeit, eigene Reflexionen über Geschichte und Gegenwart zu entwickeln und zu diskutieren, heisst es in der Medienmitteilung. Ein selbst erstelltes Zeitzeugnis können die Jugendlichen anschliessend an ihre Lehrpersonen oder Eltern schicken.
Der Holocaust ist zurzeit wieder mitten im öffentlichen Diskurs. Das hat die Kritik an der Echo-Verleihung gezeigt, bei der zwei Rapper ausgezeichnet wurden, die den Holocaust in einer Zeile arg verharmlosten. Ein ähnliches Beispiel (unpassender Vergleich) hat zum Rücktritt von Jonas Fricker (Grüne) aus dem Nationalrat geführt. Auch Forschungsergebnisse hätten gezeigt, dass das Thema Holocaust in der Gesellschaft nach wie vor heiss diskutiert wird, sagt Gautschi. Zwar habe der Diskurs heute im Vergleich zu den 80er-Jahren an Einmaligkeit verloren, weil viele Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinzugekommen sind. Es sei jedoch gelungen, Erinnerungen in den öffentlichen Raum zu bringen und sie dort zu bewahren – beispielsweise mit Filmen oder Büchern.
Erfolgreicher Testlauf
Die App hat verschiedene Testläufe hinter sich und ist durchdacht konzipiert. Sie beinhaltet drei Bausteine, die für die Geschichtsvermittlung zentral sind: Geschichten mit Menschen, den Gegenwartsbezug und interaktive Elemente. Gautschi erklärt: «Erstens fühlen sich die Jugendlichen mit den Zeitzeuginnen verbunden, weil diese aus der Kindheit berichten. Zweitens wird mit Flucht auch ein aktuelles Thema angesprochen.» Es gebe natürlich grosse Unterschiede zwischen dem Holocaust und beispielsweise dem Syrienkrieg. Das Identische sei aber, dass es um Menschen gehe, die um ihr Leben fürchten und flüchten müssen, sagt Gautschi. Der dritte Baustein, der für die Entwicklung der App wesentlich war, ist die Interaktivität. Die Schüler müssen in der App selber aktiv werden, indem sie Fragen beantworten und ein persönliches Zeitzeugnis erstellen.
Die Lehrerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der PH Luzern, Nicole Riedweg, hat die App in der Endphase mit Oberstufenklassen aus Willisau und Beckenried (NW) getestet. Sie stellt der Applikation ein sehr gutes Zeugnis aus. Die Schülerinnen und Schüler hätten das Angebot als sehr spannend und abwechslungsreich beurteilt. Der einzige Nachteil bei der digitalen Anwendung sei, dass den Zeitzeugen keine Fragen gestellt werden könnten. «Die müssen direkt an die Lehrerinnen und Lehrer gerichtet werden», sagt Riedweg. Allerdings ist man nun flexibler: Schülerinnen und Schüler können das Angebot auch zuhause oder unterwegs nutzen, die App funktioniert nach dem Herunterladen ohne Internetzugang.
Und sie funktioniert auch frei von pädagogischer Begleitung. «Wenn man das Zeitzeugenvideo schaut, kann das schon etwas auslösen», sagt Gautschi. Das vermittle neues Wissen. «Beispielsweise, dass eine Frau, die damals einen Ungarn geheiratet hat, das Schweizer Bürgerrecht verloren hat.» Dennoch ist er überzeugt, dass die App besser funktioniert, wenn man die Ergebnisse in der Schule oder sonst wo diskutiert und weitere Fakten dazu liefert.
Französischsprachige Version?
Das Schulbuch wird auch weiterhin das Leitmedium sein, ist Gautschi überzeugt. Die digitalen Medien seien jedoch anschaulicher. «Wir bleiben sicher dran an dieser Form der Vermittlung – und hoffen, dass wir unterstützt werden und eine französische oder englische Version der App machen können.» Ob das möglich sei, hänge auch von Geldgebern ab. Die Entwicklung der App kostete 140 000 Franken. Einen Drittel bezahlte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), zumal das Departement letztes Jahr den Vorsitz in der International Holocaust Remembrance Alliance hatte. Der Rest wurde durch andere Geldgeber wie Stiftungen und mit Eigenmitteln der beteiligten Partner finanziert.
Die App «Fliehen vor dem Holocaust. Meine Begegnung mit Geflüchteten» ist unter www.erinnern.at/app-fliehen, im Apple App-Store oder auf Google PlayStore downloadbar.