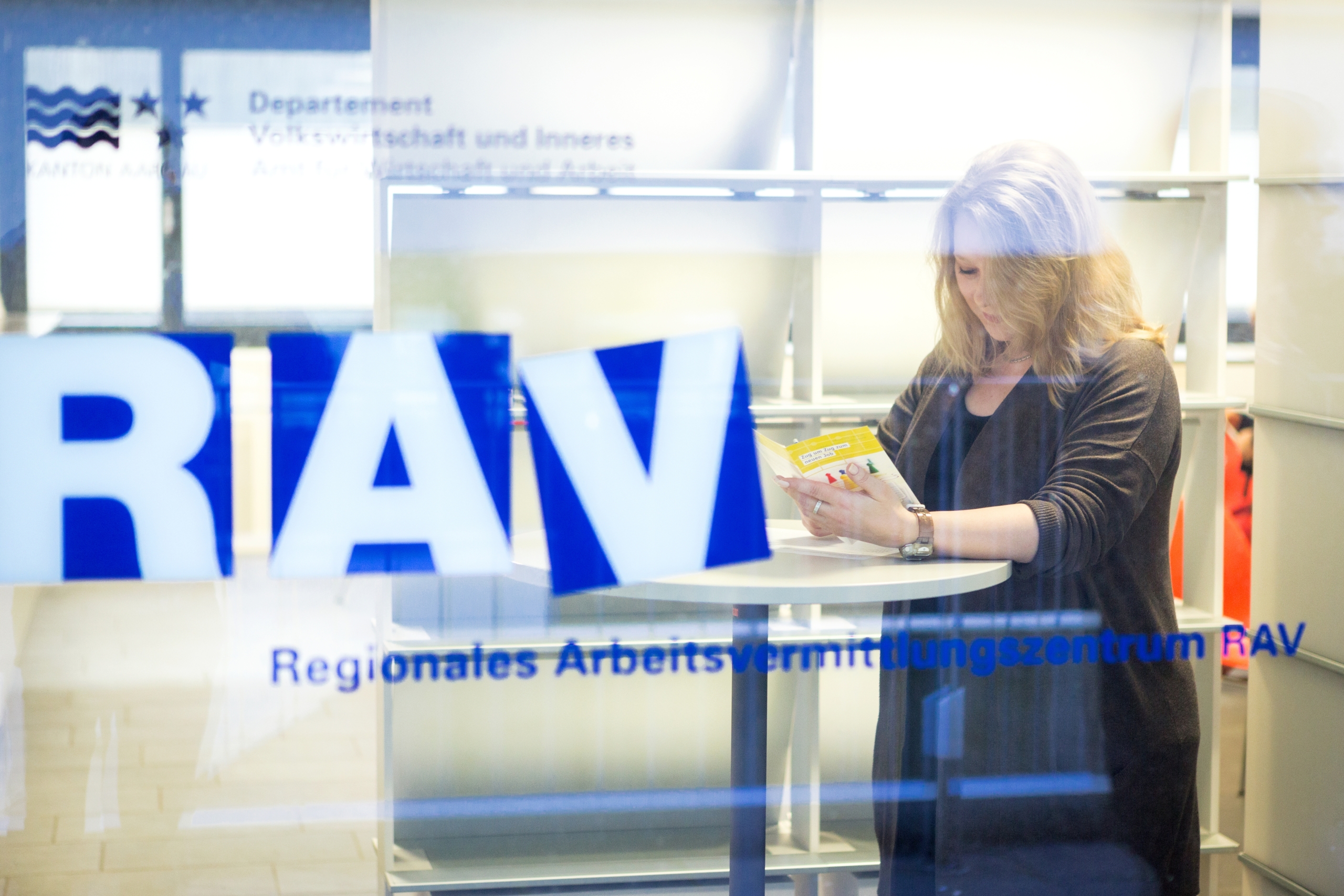EW-Fusion: Wie gross würde grösser eigentlich ausfallen?
Die Medienmitteilung schlug wie ein Blitz ein: Die vier regionalen Stromversorgerinnen tba energie ag, Aarburg, EW Oftringen AG, EW Rothrist AG und StWZ Energie AG, Zofingen, wollen Zusammenarbeitsformen bis hin zu einer Fusion prüfen (ZT vom Freitag). Um auf dem künftigen Markt bestehen zu können, ist eine gewisse Umsatz- und Strukturgrösse nötig. Wie gross die sein muss, das ist die entscheidende Frage.
Feststeht, dass die Strommarkt-Liberalisierung es künftig nicht nur Grossbezügern möglich macht, den Energiebedarf bei einer beliebigen Anbieterin zu decken. In Deutschland haben die Haushalte dieses Recht bereits, und der Markt erinnert an den Konkurrenzkampf unter unseren Krankenkassen. Jahr für Jahr buhlen die Anbieter um Kundinnen und Kunden. Marketing tut not.
Den Effekt, welchen die Liberalisierung in den lokalen Stromnetzen auslöst, zeigt die Tabelle. Unter Netznutzung ist die gesamte Strommenge zu verstehen, welche in den Kabeln des EW transportiert wurde. Der Energieabsatz besteht aus den Kilowattstunden, welche das Unternehmen direkt verkaufen kann. Die Differenz ist jener Strom, den Grossbezüger irgendwo eingekauft haben.
Strom für ihre Abonnentinnen und Abonnenten einkaufen, das müssen auch die vier EW, welche den Schulterschluss planen. Die EW Oftringen AG beispielsweise bezieht knapp 80 Prozent des Stroms über die Handelsplattform AET (Azienda Elettrica Ticinese). Weitere 20 Prozent werden auf Basis einer Vereinbarung der Energieversorger im Wiggertal bei der erzo eingekauft.
Die Stromverkäuferinnen sind auch Stromkäuferinnen
Die StWZ Energie AG ist als anderes Beispiel an der Swisspower Renewables AG beteiligt, die Wasserkraftanlagen in Italien im Portfolio hat und Miteigentümerin von On-Shore-Windparkanlagen ist. Die StWZ Energie AG hat zudem Zugriff auf regionale Stromquellen – darunter grössere Photovoltaikanlagen. Photovoltaik ist eine der technisch grossen Herausforderungen. Immer mehr Hausbesitzer richten sich auf ihrem Dach eine Anlage ein; sie sind bei eitel Sonnenschein autark und geben Strom ins Netz ab. Anders an trüben Wintertagen.
Das muss ausgeglichen werden. Das Ziel heisst Energie speichern. Grosse Tradition haben da unsere Stauseen im Gebirge, aber es gibt auch neue Ansätze wie Power to Gas. Überschüssiger Strom aus Photovoltaikanlagen wird in Wasserstoff umgewandelt. Mit dem Klimagas CO2 kombiniert, kann man aus dem Öko-Wasserstoff Methan herstellen. Um dieses anschliessend im Winter nutzen zu können, ist ein Gasnetz notwendig – wie es die StWZ Energie AG betreibt.
Eine kritische Grösse überschreiten – egal in welcher Organisationsform – ist für die regionalen EW also wichtig und nötig. Aber was ist gross? Im Verbund verkaufen die vier Werke 237,3 GWh/Jahr. Zum Vergleich: Die Eniwa AG (die früheren Aarauer Stadtwerke) bringt es auf 423,5 GWh.
Plötzlich waren Zofingens Stassenlampen dunkel
Diesen Donnerstag schaltete die öffentliche Beleuchtung in Zofingen beim Eindämmern nicht automatisch ein. Grund dafür war eine Störung in der Rundsteuerung, schreibt die StWZ Energie AG in einer Mitteilung. Ausgelöst wurde diese durch eine Umschaltung auf der Baustelle «Henzmannkreisel», welche zu einer Überlastung eines technischen Geräts bei der Trafostation Falkeisenmatte führte.
Der StWZ-Pikettdienst habe sofort nach der Ursache des Ausfalls gesucht, um diesen raschmöglichst beheben zu können. Der Defekt war um 22 Uhr behoben, so dass die öffentliche Beleuchtung in Zofingen wieder eingeschaltet werden konnte.