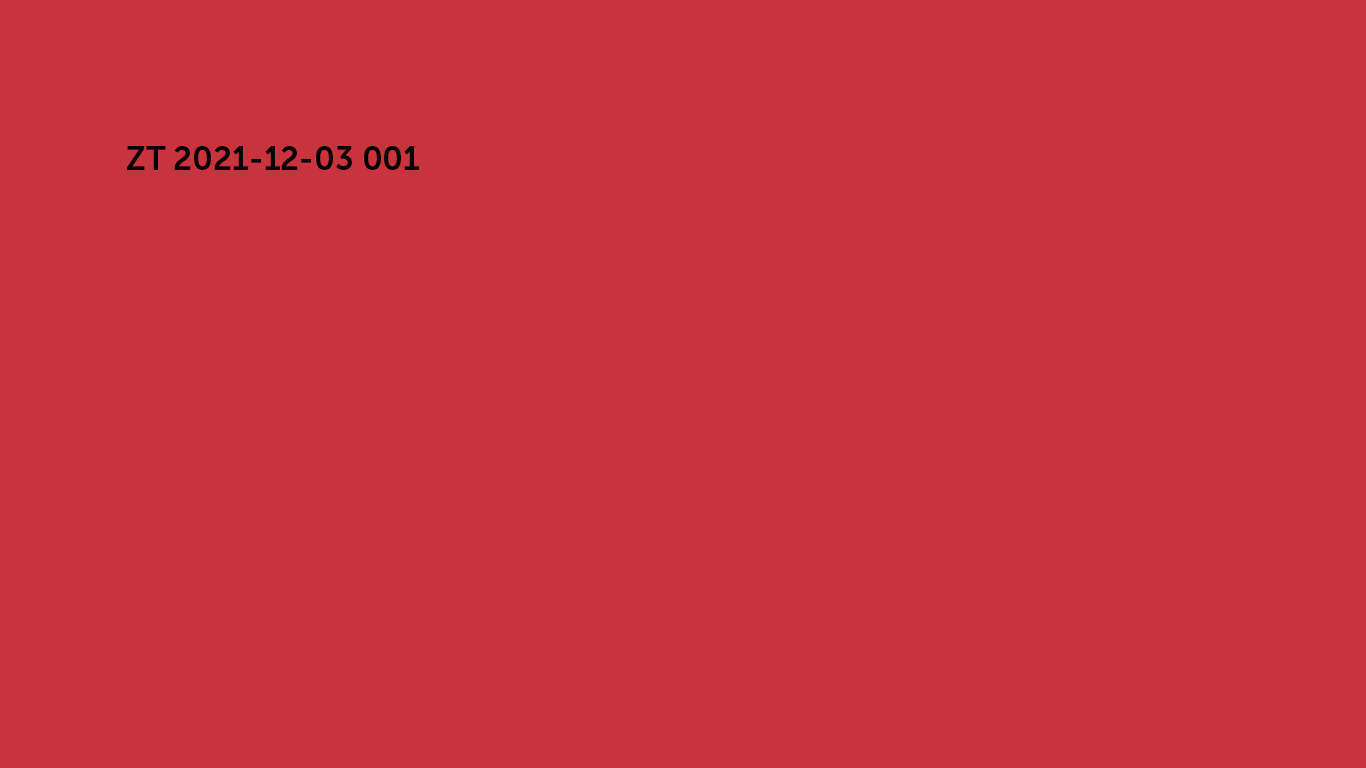Folter: «In vielen Systemen ist das Geständnis die Krone der Beweise»
Auf die Folter spannen ist ein geflügeltes Wort, das schon lange keinen Fuss mehr auf Schweizer Boden gesetzt hat. Das Sprachbild ist veraltet. Wenn es in der Schweiz so etwas wie Folter gibt, dann ist es die Isolationshaft in Untersuchungsgefängnissen. Unlängst wurde kritisiert, dass Häftlinge im Kanton Zürich 23 Stunden am Tag alleine und isoliert eingeschlossen werden.
In anderen Staaten ist das Sprachbild nach wie vor passend. Dies bestätigte Manfred Nowak am Dienstagabend an der Universität in Luzern. Der 67-jährige österreichische Menschenrechtsanwalt war von 2004 bis 2010 Sonderberichterstatter der UN-Menschenrechtskommission für Folter und andere grausame Behandlungen. In seiner Funktion bereiste er 18 Staaten auf der ganzen Welt – von Uruguay bis in die Mongolei. In 17 davon sei Folter angewendet worden, lautet sein Fazit. Er kritisiert, dass Folter als Kavaliersdelikt angesehen wird. Und, dass Opfer von Folter kaum Wiedergutmachung erhalten.
Absolutes Verbot
Anlässlich der Sommer-Universität, einer Veranstaltungsreihe der Universität Luzern zum Thema Ethik im globalen Kontext, hielt Manfred Nowak ein öffentliches Referat darüber, wie sich das absolute Folterverbot begründen lässt. Oder umgekehrt: Wieso das Recht auf Menschenwürde nicht angetastet werden darf. Während die meisten Rechte in einer Demokratie wägbar seien und auch sein sollten, sei das Recht auf Menschenwürde als absolut anzusehen. Das Recht auf die freie Meinungsäusserung ist beispielsweise einzuschränken, sobald sich jemand rassistisch äussert. «Die Einschränkung des Rechts auf Würde, also auch Folter, ist aber nie gerechtfertigt – weder im Krieg noch bei der Terrorismusbekämpfung», sagte Nowak.
Vor allem bei Letzterem werde das Folterverbot vielfach relativiert. In der Fachsprache nennt sich das das Ticking-Bomb-Szenario, wonach ein Terrorist gefoltert werden soll, damit er den Standort einer tickenden Zeitbombe preisgibt, die möglicherweise Menschen gefährden könnte. Die Bezeichnung fusst auf einem ähnlich gelagerten Fall, den Daschner-Fall: Der ehemalige stellvertretende Frankfurter Polizeipräsident Wolfgang Daschner, der eine Folter angeordnet hat, wurde 2004 vom zuständigen Landgericht verurteilt. Dieses kam zum Schluss, dass keinerlei Straftat die Anwendung von Folter legitimiere und unerheblich von drohender Gefahr keinesfalls zu rechtfertigen sei. Manfred Nowak führte dieses Beispiel an, um seine These zu untermauern.
Manfred Nowak hat die Gräuel von Folter in 17 Staaten mit eigenen Augen gesehen, konnte mit Insassen und mit Folterern sprechen. Die Staaten Russland, Kuba und Zimbabwe verweigerten ihm die Überprüfung von Gefängnissen oder liessen ihn erst gar nicht einreisen. In Jordanien konnte er zusammen mit forensischen Spezialisten im Jahr 2006 nachweisen, dass Gefangene an den Händen aufgehängt wurden. Jordanien habe ihre Foltermethoden damit gerechtfertigt, dass auch die USA, «das Mutterland der Demokratie», sie anwende, sagte Nowak. Bei seinem Besuch in Äuqatorial Guinea 2008 seien Kinder eingesperrt worden. In Nigeria habe er «einer der schlimmsten Orte» gesehen, wo rund 120 Menschen in einem Raum ausharrten und Häftlinge vor den Augen anderer gefoltert worden seien.
«Folterer sind auch Menschen»
Abschliessend sagte Manfred Nowak relativierend, dass die Haftbedingungen in vielen Ländern besser geworden seien. Es gebe Fortschritte in Lateinamerika; dort habe man ein Bewusstsein für das Unrecht schaffen können. In vielen Staaten komme hinzu, dass Beamte schlecht ausgebildet und bezahlt würden, sagte Nowak. Das System sei das Problem. «Folterer, das sind Menschen wie du und ich, das musste ich auch erst lernen», sagte Nowak. Zudem verfügen Polizeikorps in Staaten mit schlechten Strukturen kaum über kriminaltechnische Anwendungen wie die DNA-Analyse, die ihnen bei Ermittlungen helfen würden. «In vielen Systemen ist das Geständnis die Krone der Beweise.» Der Druck vom Staat auf die Polizei sei gross. Auf Ohnmacht folgt schliesslich die Folter.