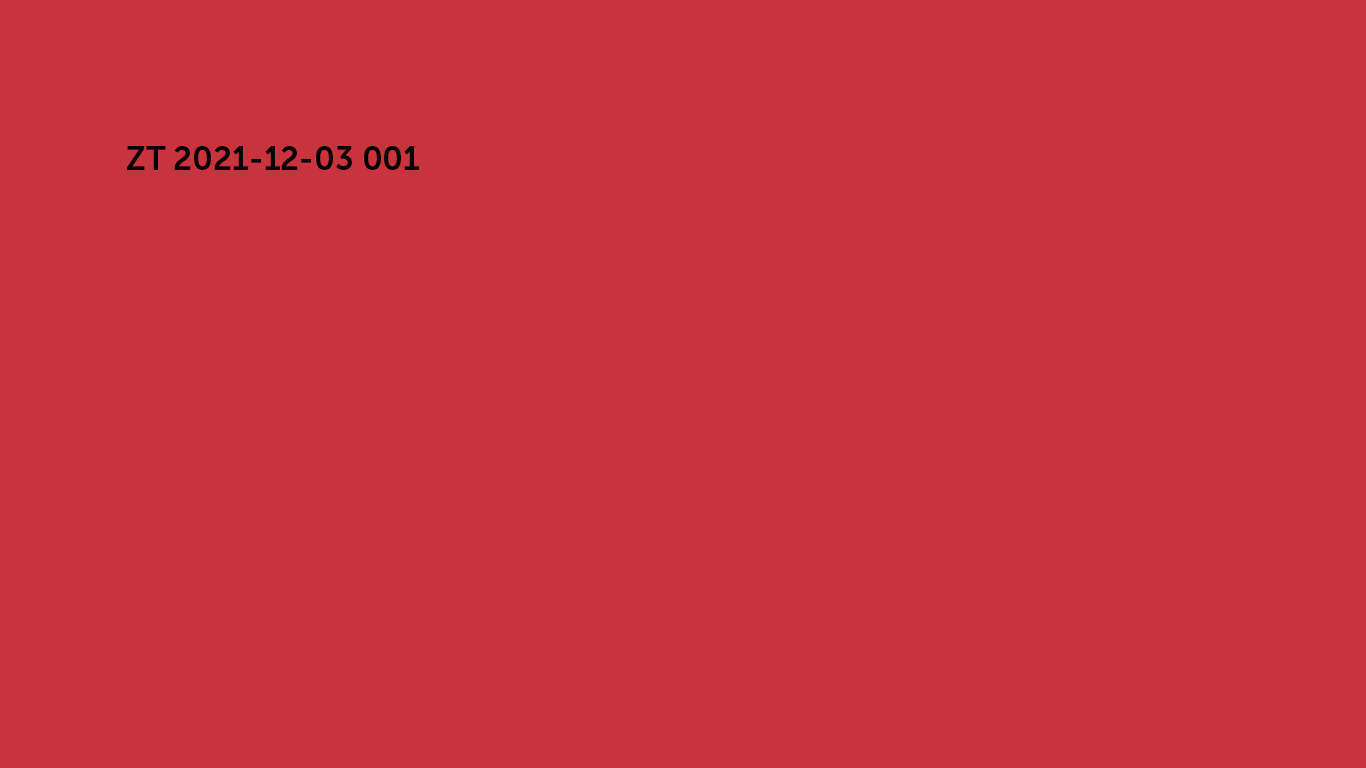Ida Glanzmann: «Auf dem Dorfplatz müssen Kreuze Platz haben»
Ida Glanzmann, ich nehme an, Sie treten nächstes Jahr wieder an?
Ida Glanzmann: Im Kanton Luzern gilt bei der CVP das ungeschriebene Gesetz, dass nationale Parlamentarier 16 Jahre im Amt bleiben können – das nehme ich in Anspruch, dieses Jahr bin ich 12 Jahre im Parlament. Ja, ich trete nochmals an.
Wer hat Sie eigentlich politisiert – Ihr Vater, der selbst sehr aktiv war?
Mein Vater hat mich diesbezüglich eher negativ beeinflusst; er war ja abends viel weg, und wir hätten ihn gerne ein bisschen mehr zu Hause gehabt. Später, in der Handelschule, musste ich eine Arbeit gegen den EWR schreiben, ich war aber dafür. Ich ging zum Ortsparteipräsidenten in Altishofen und sagte: «Wenn Du etwas für diese Abstimmung organisierst und ich helfen kann – ich bin dabei.» So fing das Politisieren an.
Seit Ende 2015 hat die CVP 25 kantonale Sitze verloren, bei den Nationalratswahlen betrug der Wähleranteil historisch tiefe 11,5 Prozent. In Zürich ist sie aus dem Stadtparlament geflogen. Wo will die CVP 2019 hinkommen?
Unser Ziel ist klar halten, wenn möglich gewinnen. Ein Lichtblick war Genf, wo wir im Parlament einen Sitz gewonnen haben. Die Genfer haben einen aktiven Wahlkampf betrieben und sind auf ihre Wählerinnen und Wähler zugegangen. Egal, ob man links oder rechts politisiert: Wichtig ist, dass man bei der Basis ist. Das gilt auch für uns: Wenn wir gewinnen wollen, können wir das nur mit der Basis tun. Leider haben wir in Genf aber auch einen Regierungssitz verloren, aber das war personenbezogen.
Also unzählige Auftritte und Veranstaltungen im nächsten Jahr?
Eine Parteiveranstaltung im Säli nützt uns wenig, man ist unter sich. Wir wollen raus und neue Wähler ansprechen – oder Wähler, die die CVP zwar gut finden, aber keine Parteiveranstaltungen besuchen.
Und wie macht man das konkret?
Social media werden im nächsten Wahlkampf sicher ein Thema sein; sicher auch wichtig ist der Wahlkampf auf der Strasse. Früher ging man von Haus zu Haus. Ich finde dies auch heute noch nicht schlecht, man lernt die Leute kennen und spricht mit ihnen.
Zunächst gibt es in Ihrem Kanton kantonale Wahlen, das wird ein wichtiges Signal werden.
Ja, diese Wahlen sind für uns sehr wichtig. Und nach den Wahlen im Frühjahr, im Mai 2019, werden wir unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den nationalen Wahlkampf im Herbst nominieren. In anderen Kantonen passiert das schon früher.
Die Luzernerinnen und Luzerner werden eventuell eine reine Männerregierung wählen. Das muss Ihnen zu denken geben.
Tatsächlich ist es schwierig, Frauen für die Politik zu motivieren. Kürzlich sind mir Dokumente aus meiner Zeit als Präsidentin der CVP Frauen in die Hände gekommen; man könnte die Forderungen von damals heute genauso übernehmen.
Sind sie ernüchtert in diesem Punkt?
Vor 20 Jahren haben Frauen extrem dafür gekämpft, dass sie ihre Positionen in der Politik einnehmen können. Heute sind sie eher darum bemüht, dass sie ihre beruflichen Positionen halten können – das finde ich auch sehr wichtig. Viele Frauen sagen mir: Ich habe meine Familie, ich habe meinen Beruf – Politik dazu ist einfach zu viel.
Auch in der Privatwirtschaft ist es nicht einfach, Frauen für Kaderpositionen zu gewinnen.
Mehr als die Hälfte der Personen, die ein Studium anfangen, sind Frauen. Da frage ich mich schon: Wo sind sie danach? Frauen müssten vermehrt bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, sie müssten auch mutiger sein. Was aber klar ist: Mit einem 40-Prozent-Job kann man keine Kaderposition einnehmen.
Gerhard Pfister trat an, um die CVP wieder klarer konservativ-bürgerlich zu positionieren. Das ist nicht unumstritten. Linke CVPler haben die Christlich-Soziale Vereinigung (CSV) Schweiz gegründet. Geht die CVP gespalten in die Wahlen 2019?
Nein, überhaupt nicht. Die CSV gibt es schon lange – unter dem Namen CSP, aktiv ist diese zum Beispiel in Obwalden, Zug und im Oberwallis. Die CSV ist eine Vereinigung, wie andere innerhalb der CVP: die CVP Frauen oder CVP 60+ zum Beispiel. Gerhard Pfister betont das bürgerlich-soziale Element der CVP-Politik, das umschreibt unsere Werte sehr gut. Mit unseren Werten sind wir teilweise im klar wertkonservativen Lager, das unterstütze ich. Trotzdem sind wir breit aufgestellt und offen gegenüber anderen Meinungen.
Die zurücktretende Zürcher Nationalrätin Barbara Schmid-Federer hat kürzlich kritisiert, mit dem prononciert konservativ-bürgerlichen Kurs der nationalen Parteileitung werde es nicht gelingen, das Wählerpotenzial in den urbanen Regionen anzuzapfen.
Das ist ihre persönliche Meinung. Ich höre aus den Städten auch andere Stimmen. Die CVP hat demokratisch ihre Leitlinien verabschiedet, da haben auch die Städte mitgestimmt. Dort geht es um Werte wie Freiheit und Solidarität, Souveränität und Offenheit, Menschenwürde und Fortschritt. Werte, die auch in den Städten, verbunden mit aktuellen Themen, umgesetzt werden können.
Wird die CVP als die Partei mit dem integrativsten Ansatz zerrieben?
Bis zu den letzten Wahlen konnte die CVP das Zünglein an der Waage spielen: Wir gaben oft den Ausschlag, in welche Richtung ein Entscheid im Parlament fiel. Das haben wir sehr bewusst gemacht, und wir machen es weiterhin, denn die CVP ist jene Partei, die viel zu Lösungen beiträgt. Das ist das Spannende in unserer Partei; ich hätte Mühe, wenn wir immer auf der linken Seite wären, genauso, wie ich Mühe hätte, wenn wir immer rechts wären. Dies führte aber auch dazu, dass man uns den Vorwurf machte, nicht zu wissen, was wir wollen. Mit diesen Positionen sind wir aber bürgerlich-sozial.
Bayern hat kürzlich die Aufhängung von Kreuzen in öffentlichen Gebäuden des Freistaats angeordnet. Eine gute Sache?
Wir fordern das immer wieder, und es steht auch in unserem Islam-Papier: Wir wollen christliche Symbole im öffentlichen Raum zulassen. Auf einem Dorfplatz oder auf einem Berg müssen Kreuze Platz haben. Unsere Kultur ist christlich geprägt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir alle anderen Kulturen zulassen, gleichzeitig aber unserer eigenen Kultur keinen Platz mehr zugestehen wollen. Dagegen wehre ich mich.
Wer ist der geeignete Nachfolger oder die geeignete Nachfolgerin für Doris Leuthard?
Sobald Doris Leuthard ihren definitiven Rücktritt bekannt gibt, wird es spannend werden: Wir haben ein paar Kandidatinnen und Kandidaten, die interessiert sind. Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten werden in eine Ausmarchung gehen.

Genannt werden immer wieder der Luzerner Ständerat Konrad Graber oder der Solothurner Ständerat Pirmin Bischof. Wen würden Sie noch nennen?
Bundesrätin Doris Leuthard ist immer noch im Amt und ich will nicht über ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger spekulieren.
Gerhard Pfister hat vor ein paar Tagen klar signalisiert, nicht Bundesrat werden zu wollen. Eine schlechte Nachricht für die Partei?
Auf der einen Seite habe ich dies mit Bedauern gehört, auf der anderen Seite gibt es unserer Partei die Sicherheit, dass er die Partei bis zu den Wahlen führen wird. Er leistet eine riesige und wertvolle Arbeit für unsere Partei, ist sehr präsent und leitet auch den Wahlkampf. Ich bin dankbar, dürfen wir auf ihn zählen.
Sie sind im September 2019 seit 12 Jahren im Nationalrat. Wie hat sich die politische Arbeit seither verändert?
Am Anfang habe ich oft erlebt, dass bei schwierigen Geschäften ein Konsens gesucht wurde. Ein Geschäft wurde schon in der Kommission so erarbeitet, dass man auf eine gute Mehrheit bauen konnte. Nur ab und zu gab es einen Unfall mit einer unheiligen Allianz. Wenn ich zurückblicke, stelle ich fest, dass wir damals ganz anders miteinander diskutierten. Heute wird schon mit dem Referendum gedroht, bevor eine Botschaft vorliegt; konkret hat das vor kurzem «Pro Tell» beim Waffenrecht so gemacht und die SVP wurde gleichzeitig noch ins Boot geholt. Da frage ich mich schon: Was soll die Arbeit im Parlament überhaupt noch? Der Tenor war: «Egal was ihr macht, wir ergreifen das Referendum.» Das halte ich für sehr unseriös. Oder nehmen sie den Rahmenvertrag der EU: Es liegt noch gar nichts vor, und schon heisst es: «Den wollen wir nicht!»
Konflikt statt Konsens als Programm?
Ja. Mein Verdacht ist: Die SVP verliert Themen, mit denen sie sich mit der Basis identifizieren konnte; beispielsweise das Asylthema. Es werden nun Themen gesucht, mit denen man bei der Basis wieder punkten kann.
Die Leute können heute auf vielen Kanälen ihre Meinung äussern, es wird aber auch schneller geschossen.
Ja, manchmal finde ich die Kommentare, die einem auf Online-Portalen begegnen, erschreckend. Vernichtend und in einer Sprache ohne Anstand, ohne Respekt – das finde ich schlimm.
Ein konkretes Thema: Die CVP präsentiert zum Wahljahr 2019 die Initiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen». Wie das geschehen soll, lässt der Initiativtext offen. Ganz konkret: Wie kriegt man die Kostenexplosion in den Griff?
Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Wir möchten, dass sich Krankenkassen und Kantone die Kosten für ambulante wie stationäre Behandlungen teilen. Heute teilen sich Kassen und Kantone die stationären Kosten, an ambulante zahlt der Kanton nichts. Der Kanton Luzern hat jetzt entschieden, dass gewisse Behandlungen nur noch ambulant gemacht werden – er zahlt also für diese keinen Beitrag mehr.
Und verkauft es als Sparübung?
Ja, damit ich habe ich Mühe. Es ist eine Kostenumlagerung, jetzt zahlen einfach die Kassen mehr Leistungen. So lange wir so wirtschaften, werden wir keine Einsparungen erzielen. Ich bin dafür, dass mehr Behandlungen ambulant gemacht werden, da gibt es Sparpotenzial, aber die Kosten sollten ambulant und stationär geteilt werden.
Die Chefin der CSS-Krankenkasse Philomena Colatrella schlägt eine radikale Erhöhung der Mindestfranchise vor: Sie soll 5000 oder gar 10000 Franken betragen. Wäre das nicht ein schnellerer, einfacherer und wirksamerer Weg?
Wenn man diese nackten Zahlen anschaut, dann ist dies der Weg zur Zweiklassenmedizin. Die einen, die es sich leisten können, ihre Leistungen zu finanzieren und die anderen, die sich kaum mehr einen Arztbesuch leisten können. 5000 Franken ist ein No-Go, das können sich viele Leute nicht leisten. Es wurden im Parlament Vorstösse überwiesen, um die Mindestfranchise von 300 Franken auf 600 Franken zu verdoppeln – darüber kann man diskutieren.
Im neuen Geldspielgesetz, über das wir am 10. Juni abstimmen, führen wir Netzsperren ein. Ist das wirklich ein gangbarer Weg im Zeitalter der Digitalisierung, zumal die Casino-Lobby das Gesetz stark beeinflusst hat?
Der Input, wie das Gesetz nun verabschiedet wurde, kam sicher von den Casinos. Aber: Sogar Länder, die liberal mit Geldspielen umgehen, kennen Netzsperren, beispielsweise Dänemark. Dänemark vergibt Konzessionen ausserhalb des Landes, hat aber zusätzlich Netzsperren. Ein Grund, wieso wir die Kontrolle in der Schweiz behalten wollen, sind die Abgaben, die in den Lotteriefonds fliessen, der für Sport- und Kulturvereine enorm wichtig ist. Für die wird es immer schwieriger, Sponsorengelder aufzutreiben. Zudem werden bei uns Steuern bezahlt, die ausländische Casinos so nicht bezahlen.
Weckt das nicht Begehren von anderen Branchen, den digitalen Markt abzuschotten?
Diese Befürchtungen teile ich nicht. Es geht hier konkret um das Geldspielgesetz und Abgaben, die für viele im Land sehr wichtig sind.
Sie haben sich im Nationalrat gegen eine referendumsfähige Olympia-Vorlage ausgesprochen. Wieso wollen Sie den Olympia-Entscheid am Volk vorbeischmuggeln? Immerhin geht es um eine Milliarde.
Wir haben heute ein jährliches Bundes-Budget von rund 70 Milliarden. Bei der Olympiade geht es um eine Milliarde. Es stellt sich die Frage, ob das Volk über alle finanziellen Entscheide abstimmen soll. Zum Beispiel über die Entwicklungshilfe oder die sechs Milliarden Bildungsausgaben? Das Parlament hat die Budgethoheit, die sollte man auch bei solchen Beschlüssen, wie der Olympiade so belassen.
In anderen Ländern verrotten die teuer gebauten Olympia-Bauten.
Die Schweiz will die Olympiade ja nachhaltig angehen, sie will bestehende Infrastrukturen nützen. Zudem würde unser Tourismus profitieren können.
Zur Person
Ida Glanzmann-Hunkeler (Jahrgang 1958) ist mit vier Brüdern und drei Schwestern auf einem Bauernhof in Ebersecken LU aufgewachsen. Sie besuchte die Schulen in Altishofen und Ebersecken, verbrachte Sprachaufenthalte in der Westschweiz und im Tessin und absolvierte danach eine Ausbildung als diplomierte Pflegefachfrau. Später schloss sie eine Betriebs- und Verwaltungsschule mit dem Diplom als Kauffrau ab. Von 2004 bis 2008 war sie für das Regionale Verkehrsbüro Willisau tätig. Eines ihrer aktuellen Mandate ist das Präsidium der LU Couture AG Willisau. Ida Glanzmann-Hunkeler engagiert sich in diversen Verbänden und Vereinen; so ist sie unter anderem Präsidentin der Pro Senectute des Kantons Luzern und Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft Kanton Luzern. 1995 wählten sie die Luzernerinnen und Luzerner ins Kantonsparlament. Zwischen 1997 und 2004 war sie Vizepräsidentin der kantonalen CVP, ab 1998 sass sie im Vorstand der CVP Frauen, die sie zwischen 2001 und 2009 präsidierte. Seit 2001 ist sie Mitglied des Präsidiums der CVP Schweiz, seit 2008 als Vizepräsidentin. Im Sommer 2006 rückte sie für den abtretenden Josef Leu als Nationalrätin nach und wurde dreimal mit Glanzresultaten wiedergewählt. Sie ist Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Ida Glanzmann-Hunkeler ist mit Walter Glanzmann verheiratet. Sie wohnt in Altishofen und ist Mutter von drei erwachsenen Kindern.