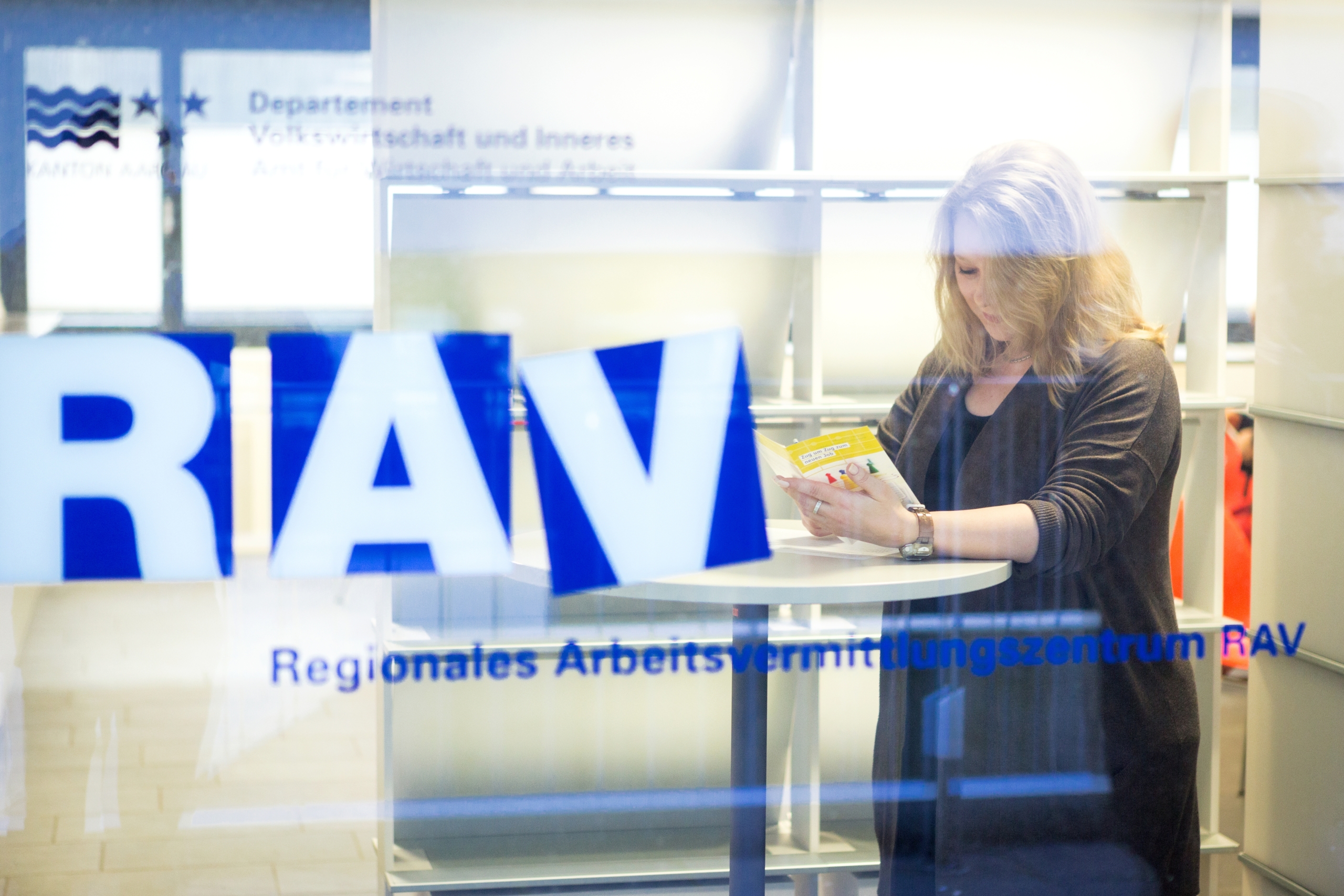Im Kampf gegen Kindsköpfe
Brennende Abfallkübel, eingeschlagene Fenster, Sprayereien, aufgeschlitzte Autoreifen – Vandalismus ist ein altbekanntes Phänomen, das sich in den Sommermonaten häuft. Oft sind betrunkene Jugendliche die Übeltäter.
Ärgerlich, schon wieder hat die gute alte Schulhauswand einen neuen Schriftzug bekommen und aus dem Abfalleimer raucht es noch immer – dieses Werk von Vandalen ist nur eines von vielen. Jetzt, in den warmen Sommermonaten, gehen vermehrt Sachschadensmeldungen bei der Polizei ein. Oftmals geschehen diese Vandalismus-Akte aus dem Affekt heraus nach Open Airs oder Partys. Viele Täter sind Jugendliche. «Die sind alkoholisiert und daraus entsteht dann ein Blödsinn», sagt Markus Heiniger, Chef der Jugendpolizei.
Die Strafen, die für die Jugendlichen aus ihren Taten resultieren, sind unterschiedlich. «Das wird über das Jugendstrafrecht geahndet. Die Beweggründe werden für das Ausmass der Strafe mitberücksichtigt, während bei einem Erwachsenen die Strafe klar gesetzt ist», erklärt Heiniger.
Täter-Suche in Schöftland
Dass es sich schwierig gestaltet, gegen Vandalen vorzugehen, erfährt auch die Schule Schöftland. Sie hat Ende letzten Jahres eine Belohnung von 500 Franken ausgesetzt. Vandalen hatten die liebevoll errichteten Skulpturen der Primarschüler zerstört. Bisher wurde niemand gefasst.
Dennoch können solche Belohnungen helfen, die Täter zu überführen – so auch in der Gemeinde Schöftland geschehen. «Vandalen verhalten sich im Kollegenkreis oft unvorsichtig», weiss Roland Pfister, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau. «Eine Belohnung kann durchaus ein Ansporn sein, den Kollegen zu verraten.»
Die Regionalpolizei Zofingen hat die Polizeipräsenz an besonders kritischen Punkten hochgefahren, um weiteren Vorfällen entgegenzuwirken. Betroffene sollen laut Pfister eine Anzeige machen. «Viele denken, dass eine Anzeige gegen unbekannt nichts bringt.» Sobald es aber Zeugenaufrufe gäbe, würden sich die Täter oftmals von alleine stellen, aus Angst, von der Polizei geschnappt zu werden.
Spuren lassen sich oftmals keine sichern und die Wahrscheinlichkeit, dass einer, der nachts irgendwo eine Scheibe eingeschlagen hat, später erwischt wird, ist gering. Was die Polizei in solchen Fällen weiterbringt, ist die Nachbarschaftshilfe. Wenn über den Vorfall geredet wird, was unter anderem auch durch die Medien gepusht werden kann, lässt sich eher jemand finden, der mehr über den Vorfall weiss und helfen kann. Wenn der Täter des Schadens nicht ermittelt werden kann, haftet die Allgemeinheit.
Ständig überwacht
Eine weitere, kostenpflichtige Hilfe, können Überwachungskameras sein. «Aber Kameras verlagern das Problem oftmals nur», warnt Heiniger. Dies trifft zumindest für Vandalismus-Akte zu, die im Vorfeld geplant worden sind. Tä- ter, die aus dem Affekt oder unter Alkoholeinfluss handeln, werden von Kameras oft nicht abgeschreckt. Und wie Pfister verrät: «Die Bildqualität reicht, gerade nach Einbruch der Dunkelheit, manchmal nicht aus. Mit Umrissen und Schatten können wir leider nichts anfangen.» Dennoch sind die Kameras nicht völlig nutzlos. «Von den Gemeinden, die Kameras angeschafft haben, bekommen wir durchwegs positive Rückmeldungen», sagt Wolfgang Rohr, Stellvertreter der kantonalen Datenschutzbeauftragten.
Videoüberwachungen gibt es heutzutage überall.Dennoch stellen sie einen Eingriff in den Persönlichkeitsschutz dar. Aus diesem Grund muss pingelig genau darauf geachtet werden, wo die Kameras installiert werden und dass der Umstand, dass ein bestimmtes Areal überwacht ist, kenntlich gemacht wird. So kann jeder selber entscheiden, ob er oder sie den überwachten Platz betreten will. «Unproblematisch sind Orte, an denen die Leute eine Video- überwachung erwarten, zum Beispiel bei der Entsorgungsstelle», sagt Rohr. Wichtig ist, dass mit den Videokameras «verhältnismässig» und «korrekt» umgegangen wird.
Das Bildmaterial einsehen darf nicht jedermann. Dies ist lediglich einem kleinen Kreis vorbehalten. Der Verantwortliche der öffentlichen Organe, der ressortleitende Gemeinderat und allenfalls noch ein Gemeindeschreiber dürfen sich dieses aufgezeichnete Material ansehen. «Wir arbeiten nach dem Vier-Augen-Prinzip», erklärt Rohr.