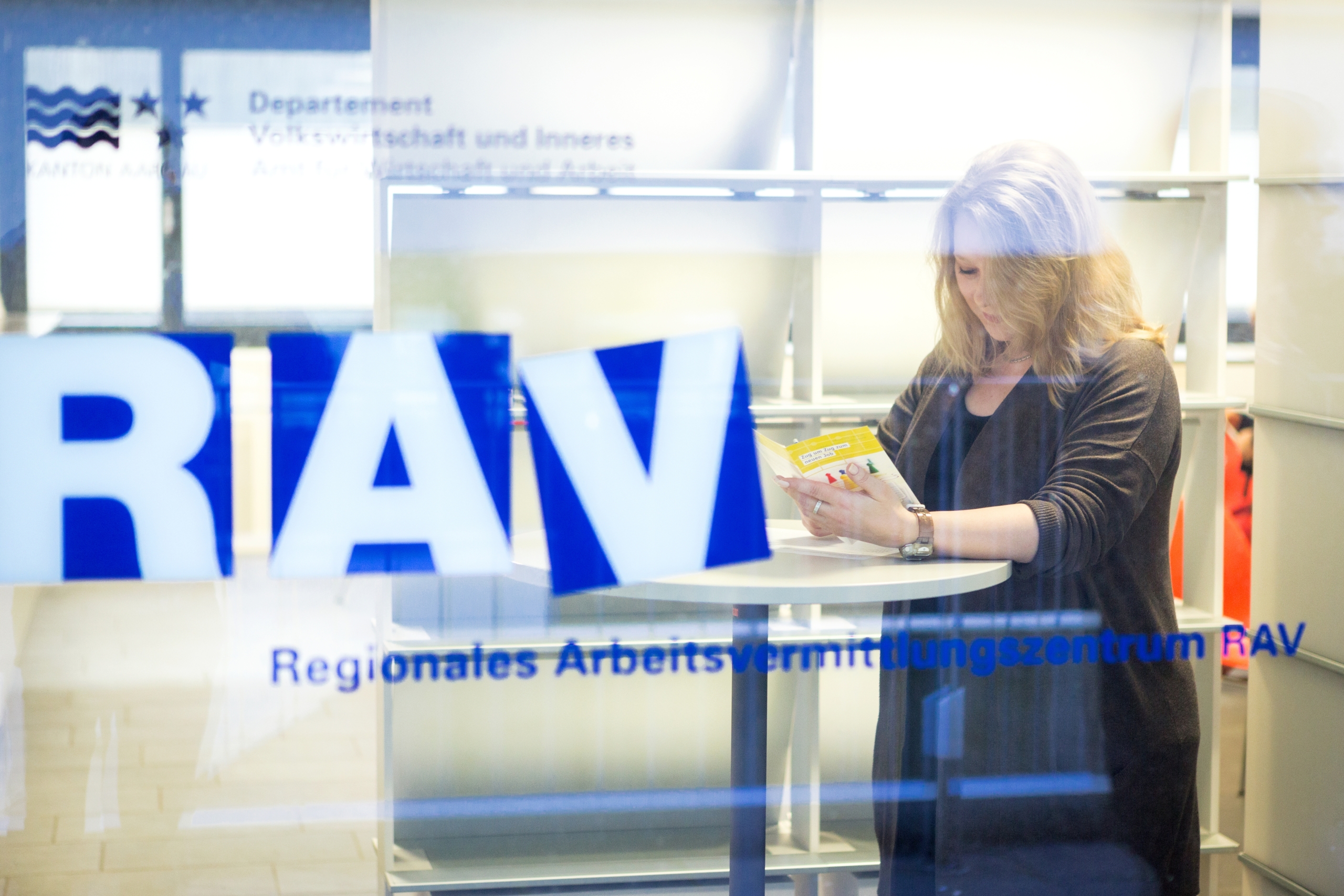Lohn-Schere bei den Bauern ist riesig – Betriebsgrösse ist nur ein Faktor
In der Landwirtschaft öffnet sich die Lohnschere. Die «Besten» verdienen im Durchschnitt sechsmal mehr als die «Schlechtesten». Eine Analyse landwirtschaftlicher Buchhaltungen durch Agroscope – das Schweizer Kompetenzzentrums für landwirtschaftliche Forschung – identifiziert vier Ursachen: Ausbildung, Betriebsgrösse und -ausrichtung sowie die Betriebsführung.
Die Betriebsgrösse ist für die Schweizer Landwirtschaft eine agrarökonomische Grundkonstante: Sie hat einen sehr stark positiven Einfluss auf den Arbeitsverdienst. Vergrössert ein Milchproduzent beispielsweise seine Herde von 25 auf 50 Kühe, wächst der Arbeitsbedarf nur unterproportional, was durch die Skaleneffekte bedingt ist.
Auch die Region spielt eine bedeutende Rolle. Die Einkommen verringern sich mit zunehmender Höhenlage. In der Talregion – also bei uns – wird deutlich besser verdient als in den Bergregionen. Dies zeigt die Analyse von über 3000 Buchhaltungen, die seit Jahren Agroscope auf freiwilliger Basis und in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt werden.
Wie sieht es in der Region Zofingen aus? Fachmann ist SVP-Grossrat Christian Glur aus Glashütten. Obwohl der Meisterlandwirt als Bauernpolitiker den Überblick hat, muss er feststellen, dass auch für ihn Unterschiede nur schwierig auszumachen sind. «In der Region hat es zwar viele typische Mittelland-Höfe mit Milch- oder Fleischproduktion, verbunden mit Ackerbau – aber auch spezialisierte Betriebe, welche Obst, Gemüse oder Weihnachtsbäume kultivieren und oft direkt vom Hof vermarkten.» Dies macht den kreativen Unterschied aus.
Glur sagt grundsätzlich: «Die Produzentenpreise sind bei vielen Produkten auf einem sehr tiefen Niveau.» Ein Beispiel: Für 100 Kilo Weizen wurden vor Jahren 110 Franken bezahlt – heute sind es 50. «Der Preiszerfall – auch bei der Milch – trägt dazu bei, dass es mit der Produktion von Lebensmitteln sehr schwierig geworden ist, das Geld zu verdienen, um die Lebenshaltungskosten bestreiten und in den Betrieb investieren zu können», sagt Glur. «Daher gehen heute viele Landwirte einem Nebenerwerb nach.»
Als Kommissionsmitglied der Landwirtschaftlichen Schule Liebegg diskutieren Glur das Problem oft und ist als Meisterlandwirt der Überzeugung, «dass sich heute ein Betriebsleiter im immer komplexeren Umfeld rund um die Landwirtschaft laufend weiterbilden muss».