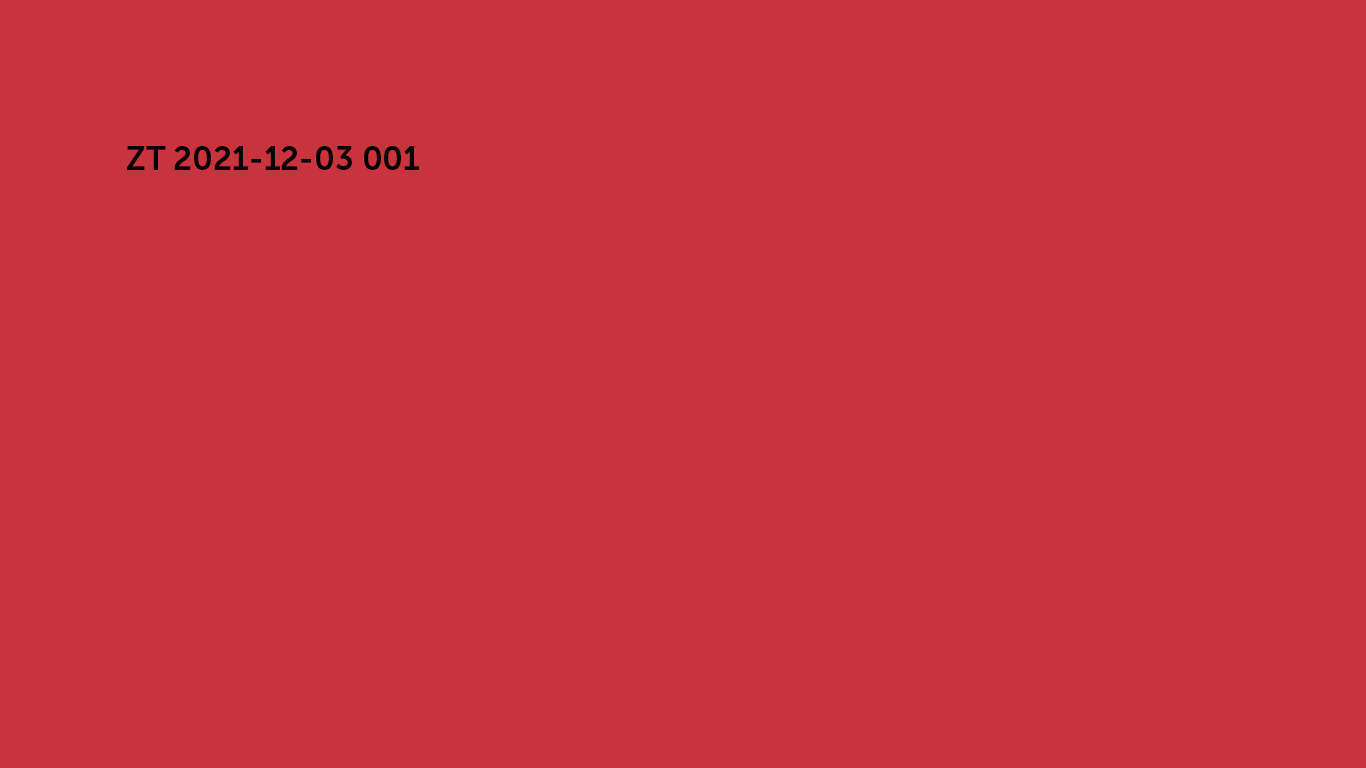Luzerner Ausgleichskasse hat bald 12,3 Millionen Franken ausbezahlt
Der Bundesrat hat zur Abfederung der finanziellen Folgen der Corona-Krise verschiedene Massnahmen definiert. Die sogenannte Corona-Erwerbsersatzentschädigung an Eltern, Selbstständige und Personen in Quarantäne wird durch die Ausgleichskassen im jeweiligen Kanton ausgerichtet.
Bis zum 7. Mai seien 6485 Gesuche für eine Corona-Erwerbsersatzentschädigung eingegangen, teilte das Luzerner Amt WAS (Wirtschaft Arbeit Soziales) gestern mit. «Über 75 Prozent davon sind bereits bearbeitet.» Die WAS Ausgleichskasse in Luzern hat laut der Mitteilung bis jetzt 12,27 Millionen Franken an die Gesuch-stellenden ausgerichtet. Diese neue Entschädigung habe zu einem massiven Mehraufwand geführt. Denn es gab keine Vorlaufzeit. Die Voraussetzungen für den reibungslosen Ablauf, die technische Infrastruktur, die Mitarbeiterschulung und Personalplanung hätten innert Rekordzeit bereitgestellt werden müssen, heisst es weiter. Zudem mussten die wichtigen Informationen für die Versicherten bereitgestellt und eine Hotline eingerichtet werden.
Noch 1500 pendente Fälle
Die noch rund 1500 pendenten Fälle würden «mit Zusatzengagement» der Mitarbeitenden «möglichst zeitnah» abgearbeitet. Alain Rogger, Leiter WAS Ausgleichskasse Luzern, sagt auf Anfrage dieser Zeitung, zehn Personen bedienten in Luzern die Hotline. Rund 25 Personen seien für die Bearbeitung der Gesuche besorgt. «Wir haben sie teilweise aus anderen Fachbereichen abgezogen und setzen auch Lernende ein», sagt Rogger. «Ziel ist es, dass bis Ende nächster Woche mindestens 90 Prozent der Gesuchstellenden eine Auszahlung, ein Abklärungs- oder ein Bestätigungsschreiben erhalten haben.»
Auch Betriebe, die nicht schliessen mussten
Laut Rogger meldeten sich am Anfang auch Betriebe, die (noch) nicht berechtigt waren. In einer ersten Phase habe der Bundesrat definiert, welche Betriebe Erwerbsersatzentschädigung beziehen könnten. «Dazu zählten zuerst Unternehmen oder Institutionen, die wegen der Corona-Massnahmen schliessen mussten, zum Beispiel Restaurants, Bars, Coiffeure, Freizeitinstitutionen wie Museen, Bibliotheken.» Doch es hätten sich nicht nur diese gemeldet. «Auch Betriebe, die offen haben durften, aber aufgrund der Corona-Krise weniger oder keine Aufträge mehr hatten, stellten Gesuche.» Alain Rogger nennt als Beispiele Beratungsfirmen oder Handwerksbetriebe. In einer zweiten Phase habe der Bundesrat dann den Kreis der Berechtigten erweitert.