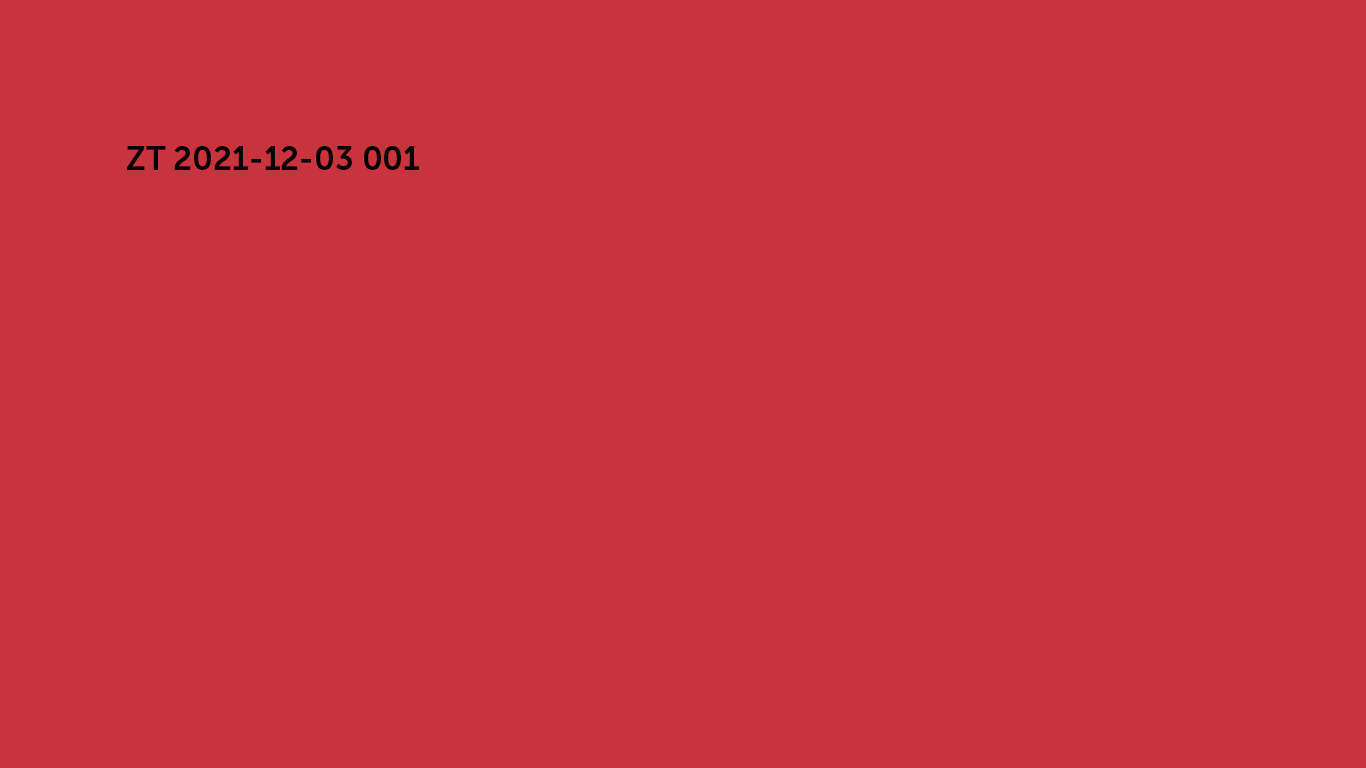Luzerner Bauernpräsident: «Wir haben gewisse Zielkonflikte»
Landwirtschaftsreformen
Tierwohl steigern, Emissionen senken
Demnächst stehen auf eidgenössischer und kantonaler Ebene Landwirtschafts-Reformen an. Im Januar 2022 soll ein neues kantonales Landwirtschaftsgesetz in Kraft treten. Gleichzeitig soll die neue Agrarpolitik ab 2022, die AP22+, greifen. Bei Letzterer hat die Vernehmlassung bereits gestartet. Der Bund will die Rahmenbedingungen in den Bereichen Markt, Betrieb und Umwelt anpassen. Damit soll die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft künftig Chancen eigenständiger und unternehmerischer nutzen, heisst es im Bericht zur Vernehmlassung, der vor rund einem Monat zum Start der Vernehmlassung publiziert wurde. Im Bericht werden auch agrarpolitische Optionen mit einem deutlich reduzierten Grenzschutz dargestellt. Gleichzeitig werden verschiedene parlamentarische Vorstösse im Gesamtkontext beantwortet. Der Bericht soll dem Parlament eine erste Diskussion zur AP22+ ermöglichen. Basierend auf dem Bericht und der parlamentarischen Diskussion wird der Bundesrat dem Parlament voraussichtlich im vierten Quartal 2019 zeitgleich mit der Botschaft zu den Zahlungsrahmen 2022 bis 2025 eine Botschaft zur Anpassung der Gesetzgebung unterbreiten.
Die Stossrichtung AP22+ fliesst auch in die Erarbeitung des neuen kantonalen Landwirtschaftsgesetzes ein. Gemäss kantonaler Landwirtschaftsstrategie, die als Basis für die Gesetzgebung gilt, und vor wenigen Wochen publiziert wurde, soll die Luzerner Landwirtschaft unternehmerischer und ökologischer werden. Als Schwächen der Luzerner Bauern nennt der Regierungsrat darin die unterdurchschnittlichen Betriebsgrössen, die hohen Boden- und Pachtpreise, hohe Produktionskosten wegen geringer betrieblicher Zusammenarbeit sowie eine hohe Schuldenlast. Zudem sollen Nutztiere vermehrt auf der Weide gehalten werden, dies um die Ammoniakemissionen zu senken und das Tierwohl zu steigern. Die Vernehmlassung zur kantonalen Gesetzgebung findet voraussichtlich 2020 statt. (rzu)
Herr Lütolf, wie haben Sie den trocknen Sommer als Landwirt erlebt?
Jakob Lütolf: Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Im Wauwilermoos können wir die Trockenheit gut verkraften. Aber wir haben sie natürlich auch gespürt – ausserhalb des Moors sind sieben Hektaren quasi verdorrt und das Futter war auch eher knapp. Der Herbst hat nun aber wieder viel gutgemacht.
Ich frage, weil der Klimawandel beziehungsweise die Ökologie in den aktuellen Landwirtschafts-Reformen ein grosses Thema ist.
An der Landwirtschaftsstrategie, die der Kanton Luzern vor wenigen Wochen publizierte, haben wir, der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband, auch mitgearbeitet. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass die Medien den Fokus nur auf die Ökologie gelegt haben. Es ist zwar ein Teilbereich, die Hauptaussage der Strategie ist aber: Die Luzerner Bauern erwirtschaften 80 Prozent aus der Tierhaltung und dazu wollen wir stehen.
Die Medien setzten den Fokus, weil der Klimawandel ein drängendes Problem ist.
Wir haben gewisse Zielkonflikte: Wir wollen ökologischer werden, aber wir wollen auch die heutige Produktion möglichst erhalten. Schliesslich produzieren wir, mit gewissen Ausnahmen, bei denen wir ein Überangebot haben, vor allem für den Schweizer Markt. Alles, was wir nicht produzieren können, müssen wir importieren. Damit exportieren wir sozusagen unsere Probleme. Und auf bestem Kulturland, wie hier im Wauwilermoos, nichts mehr zu produzieren, finde ich ethisch verwerflich. Das ist für uns nicht die Lösung. Und wenn man zwei Ziele miteinander erreichen will, geht das nicht so schnell, wie sich das vielleicht Umweltverbände vorstellen.
Letztes Jahr hat die Schweizer Stimmbevölkerung die Vorlage zur Ernährungssicherheit deutlich angenommen. Was hat das bisher gebracht?
Ich bin der Meinung, dass dem nun nachgelebt werden müsste. Für mich ist das ein klares Ja zur produzierenden Landwirtschaft. Das Level der Selbstversorgung sollte damit bei rund 50 Prozent erhalten bleiben. Aber die Agrarpolitik des Bundes ab 2022, kurz AP22+, lebt dem nicht nach. Die geht weiter in Richtung Extensivierung. Deshalb bin ich ihr gegenüber sehr kritisch.
Was ist Ihr Lösungsvorschlag?
Entweder wir können in der Vernehmlassung die Botschaft zur AP 22+ so beeinflussen, dass sie auch für uns annehmbar wird, oder wir treten gar nicht auf die Vorlage ein. Die bestehende Gesetzgebung könnte auch punktuell angepasst werden.
Zum Beispiel?
Bei der Landschaftsqualität wollen wir Punkte herausstreichen. Viele Bauern haben in den letzten Jahren Leistungen erbracht, die sie gar nicht wollten, aber die halt mehr Geld eingebracht haben. Den Getreidebau sollten wir wieder stärken. Zudem wäre es sinnvoll, die Beiträge bei besonders tierfreundlichen Stallungen zu erhöhen.
Bald stimmt die Schweizer Bevölkerung über die «Trinkwasser»- und die «Pestizid»-Initiative ab. Was ist Ihre Haltung zu diesen Vorlagen?
Wir hoffen natürlich, dass die abgelehnt werden. Wir sind in diesen Belangen, im Bereich Ammoniak und Phosphor, bereits aktiv. Wir wollen uns zudem im Pflanzenschutz verbessern und haben auch eine Antibiotikastrategie. In den letzten zehn Jahren konnten wir deren Einsatz übrigens halbieren. Wir sind gut unterwegs, aber wir wollen uns natürlich verbessern. Gleichwohl müssen beispielsweise auch Bio-Betriebe Futter zukaufen oder Pestizid spritzen, was die Initiativen verbieten wollen. Sie sind zu radikal und schiessen eindeutig übers Ziel hinaus.
Tut sich die Landwirtschaft schwer, Ihre Stärken und Schwächen zu kommunizieren?
Wir Bäuerinnen und Bauern machen nur noch zwei oder drei Prozent der Bevölkerung aus. Der Druck auf die Landwirtschaft hat zugenommen. Nicht nur im Markt, wo wir Schweizer kaufkraftbemessen am wenigsten für Lebensmittel ausgeben. Wie bereits gesagt: Es gibt auch Zielkonflikte; so sind zum Beispiel viele Tierwohlmassnahmen und die Ammoniakproblematik ein klassischer Zielkonflikt. Wir wollen nun im Vorfeld der Initiativen darauf hinweisen, was wir Bauern in den letzten zwanzig Jahren gemacht haben.
Wieso gibt es zurzeit so viele Initiativen gegen die Landwirtschaft?
Ich stelle fest: Es gibt eine gewisse Entfremdung. Vor dreissig Jahren hatte noch jede Familie einen Bezug zur Landwirtschaft. Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe hat sich seither halbiert. Gleichzeitig zeigt der Detailhandel ein idealisiertes Bild der Landwirtschaft. Das führt zu einer verzerrten Wahrnehmung. Man hat gewisse Idealvorstellungen, aber lebt völlig inkonsequent – beispielsweise isst man mit jeder Selbstverständlichkeit zu jeder Jahreszeit Erdbeeren.
Nochmals zur kantonalen Landwirtschaftsstrategie zurück: Die Luzerner Landwirtschaft soll nicht nur ökologischer werden, sondern auch ökonomischer handeln. Müssten Betriebe vor allem grösser werden?
Nein, aber die Zusammenarbeit sollte in erster Linie verbessert werden. Ich selbst habe eine Betriebsgemeinschaft mit meinem Nachbarn, wir teilen uns die Arbeit. Das macht zum einen wirtschaftlich, zum anderen aber auch sozial Sinn: punkto Freizeit und Ferien. Aber die Betriebe müssen selber bereit sein, auch das kann man nicht erzwingen.
Wie könnten Betriebe noch wirtschaftlicher werden?
Auf der Kostenseite hätten wir noch Potenzial – viele Betriebe sind übermechanisiert, also sie haben zu teure Maschinen. Klar ist: Der technische Fortschritt ist da, deshalb braucht es den Strukturwandel. Was ich jungen Bäuerinnen und Bauern aber immer wieder sage: Der Strukturwandel, also beim Wachstum, ist auch nicht alleiniger Heilsbringer.