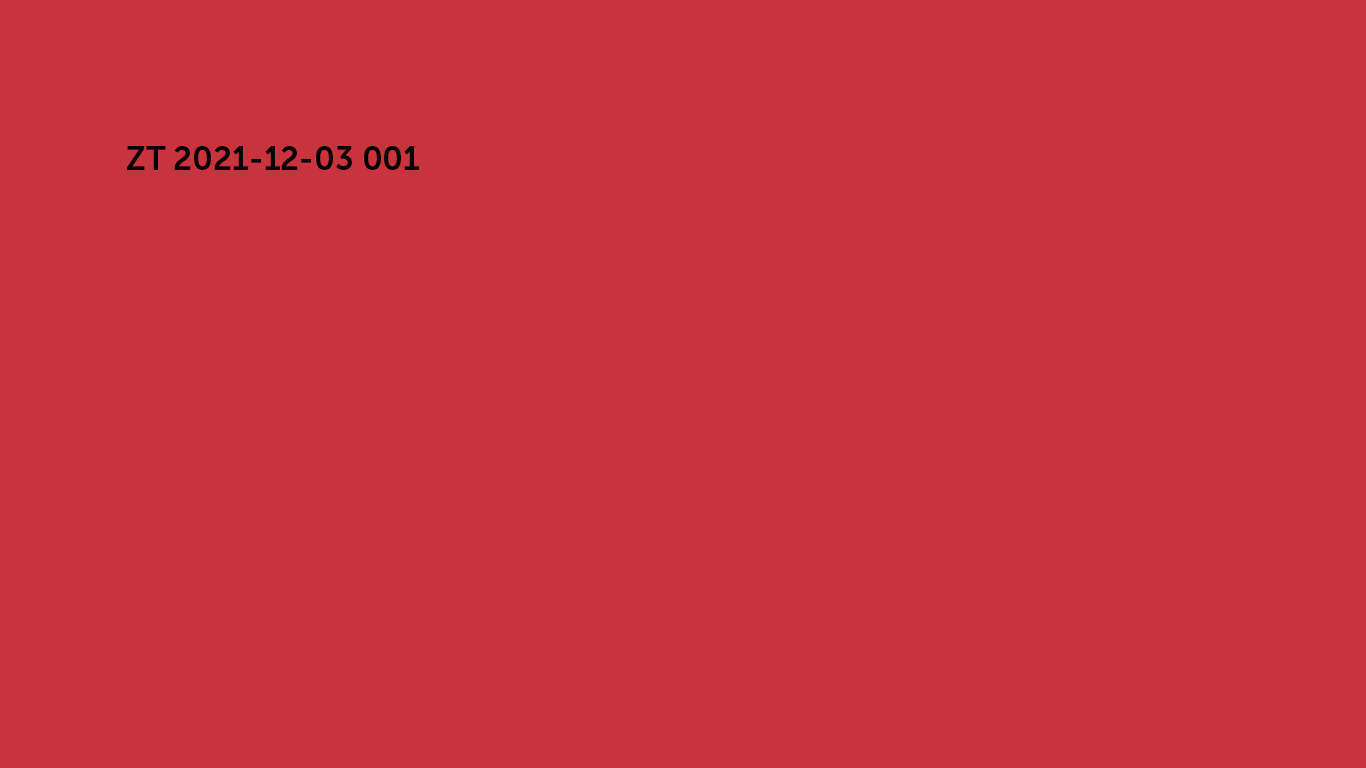Menschenhandel: Die Polizei ist ein zahnloser Tiger
Der Menschenhandel im Kanton Luzern hat stark zugenommen – jedenfalls auf dem Papier. Gemäss Statistik um 2500 Prozent. 2016 gab es einen Fall, 2017 waren es 26. Diese Zahlen präsentierte die Luzerner Polizei letzte Woche, um sie umgehend zu relativieren. Die 26 Delikte fallen teilweise auf die Jahre 2015, 2016 und wurden erst letztes Jahr abgeschlossen. Dabei handelte es sich um ein Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandel eines kriminellen Rings, der 26 Anzeigen zur Folge hatte. Von 2011 bis 2016 bewegte sich diese Zahl zwischen null und sieben Anzeigen pro Jahr.
Weitere Statistiken zeigen ein anderes Bild: Letztes Jahr verzeichnet das Frauenhaus Luzern beispielsweise keine Klientin, die von Menschenhandel betroffen gewesen wäre. 2016 waren es drei. Die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIZ registrierte 2017 zwei Fälle, die ihnen von der Opferberatungsstelle Luzern zugetragen wurden. 2016 waren es noch fünf Fälle. Die Zahlen sind irreführend, die Dunkelziffer im Menschenhandel ist riesig. Seriöse Zahlen zu dieser Straftat gebe es nicht, sagt Rebecca Angelini von der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIZ. Im Zuge der Fluchtbewegungen rechnet sie aber mit einer Zunahme, da das Migrationsregime Abhängigkeitsverhältnisse begünstige. Abnehmende Fallzahlen sind für sie indessen ein Indiz dafür, dass Fälle weniger strafverfolgt werden. Und damit hat sie recht.
Die Luzerner Polizei kommunizierte letzte Woche, dass sie über zu wenig personelle Ressourcen verfügt (wir berichteten). Bis 2015 gab es bei der Luzerner Polizei noch eine Fachgruppe Menschenhandel, in der zwei Beamtinnen oder Beamte diesem Straftatbestand nachgingen. Diese Gruppe wurde wegen fehlender Ressourcen eingestellt, sagte Daniel Bussmann, Chef Kriminalpolizei, an der Pressekonferenz. «Gewisse Gruppierungen könnten nach Luzern kommen, weil sie wissen, dass wir wenig Ressourcen haben», warnte Bussmann. Bei konkreten Hinweisen oder einem hinreichenden Tatverdacht würden die Ermittlungen momentan von Mitarbeitenden der Fachgruppe für Sexualdelikte oder anderen Bereichen der Kriminalpolizei bearbeitet, schreibt Mediensprecher Urs Wigger. Auch Angelini beargwöhnt diese Entwicklung. Die Gefahr sei real, dass sich Luzern zu einem Menschenhandel-Hotspot entwickle, wenn keine Polizistinnen und Polizisten für die Bekämpfung des Menschenhandels eingesetzt würden. Menschenhandel sei immer ein Ressourcenproblem. Die Polizei müsse proaktiv im Milieu ermitteln, die Opfer melden sich nicht von sich aus bei den Strafverfolgungsbehörden – beispielsweise aus Angst vor den Tätern. Ein weiterer Grund, wieso sich Opfer nicht direkt bei der Polizei melden, könne sein, dass die Opfer in ihrem Heimatland schlechte Erfahrungen mit Polizisten gemacht hätten, sagt Birgitte Sneftrup. Sie ist Geschäftsleiterin des Luzerner Vereins LISA, der sich für die Interessen von Sexarbeiterinnen in Luzern einsetzt und sie berät. «Wir versuchen dieses Vertrauen in die Polizei wieder aufzubauen.»
In der Schweiz, wie in anderen Zielländern des Menschenhandels, werden viele Fälle nicht aufgedeckt, schrieb die Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel (KSMM) des Bundesamts für Polizei (fedpol) in einem Factsheet im Juli 2017. Die häufigste Form von Menschenhandel in der Schweiz sei die sexuelle Ausbeutung. Die identifizierten Opfer seien vorwiegend junge Mädchen und Frauen ohne Perspektiven im eigenen Land. Sie werden durch falsche Versprechen auf eine Arbeitsstelle oder Ausbildungsmöglichkeit in die Schweiz gelockt, wo sie zur Prostitution gezwungen werden.
Neben dem Ressourcenproblem fehlt der Luzerner Polizei zurzeit auch die Rechtsgrundlage, um proaktiv Kontrollen in sogenannten Sex-Betrieben durchzuführen. Die Polizei kann heute nur Betriebe kontrollieren, wenn diese eine Gastgewerbebewilligung haben oder bereits ein hinreichender Verdacht auf strafbare Handlungen besteht. Um Sex-Betriebe ohne Durchsuchungsbefehl überprüfen zu können, bräuchte es einen entsprechenden Passus im Gastgewerbegesetz. Ein solches Instrument war Teil des neuen Gesetzes über die Sexarbeit, das der Kantonsrat im September 2015 ablehnte. Regierungsrat Paul Winiker kündigte an der Pressekonferenz letzte Woche an, die entsprechende Anpassung des Gastgewerbegesetzes erneut dem Parlament zu unterbreiten. Dies soll mit einer Aufstockung der personellen Ressourcen der Polizei einhergehen. «Ab 2019 ist eine jährliche Aufstockung um fünf Stellen wieder in Angriff zu nehmen», sagte er.
Für Rebecca Angelini ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn man Massnahmen ergreife, müsse man aber aufpassen, dass sich diese nicht gegen Sexarbeiterinnen richten. «Oftmals beobachten wir, dass Massnahmen eingeführt und als Schutz von Frauen verkauft werden. In der Praxis sieht man dann aber, dass es reine behördliche Auflagen sind, die den Frauen keinen Schutz gewähren, sondern ihnen zusätzliche Hürden stellen und sie so in die Illegalität abrutschen.» Wenn Beamtinnen und Beamte aber in den Betrieben prüfen, wie es den Frauen gehe und zu welchen Bedingungen sie arbeiten, könne das sehr viel bringen.