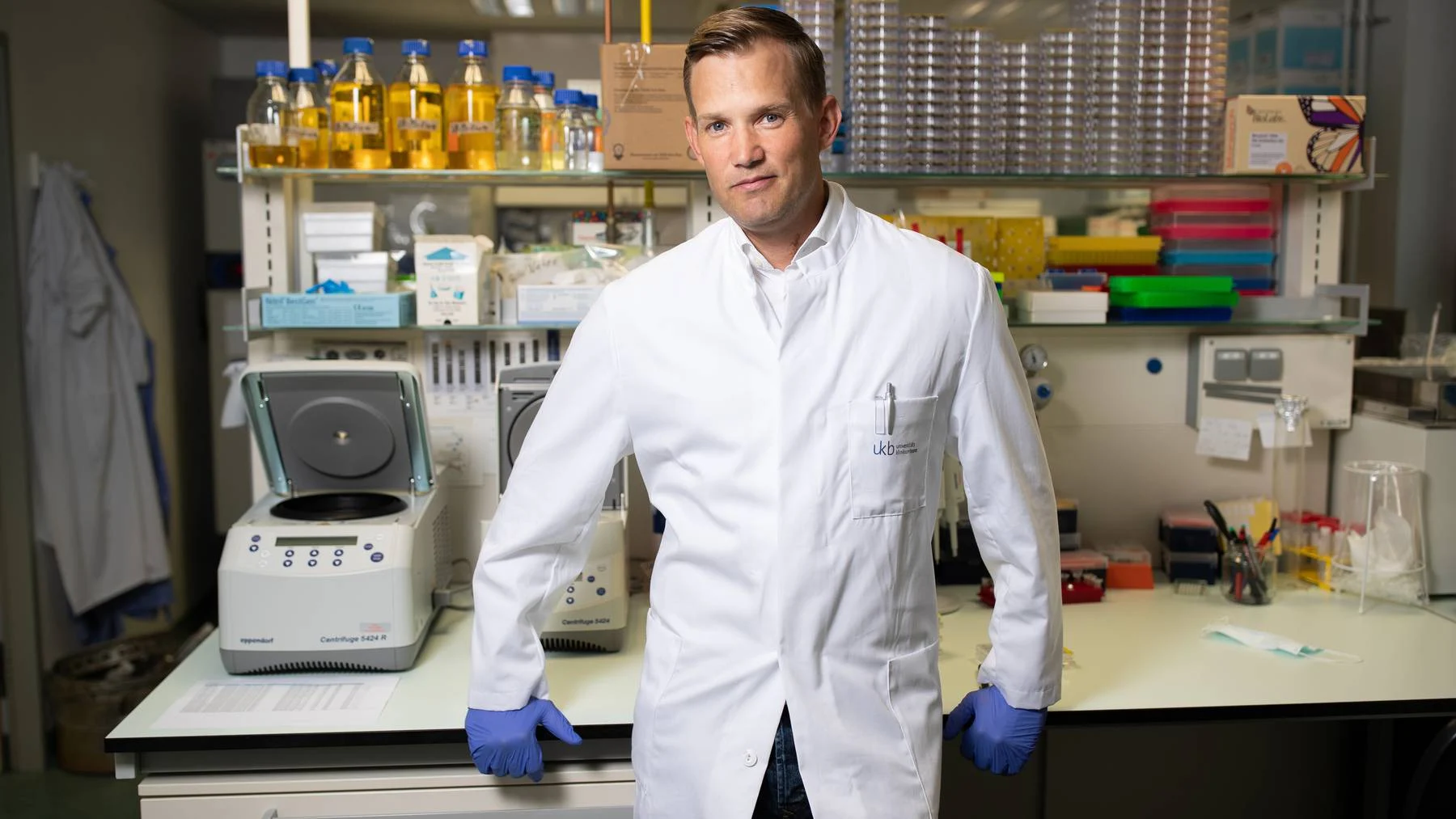
Starvirologe Hendrik Streeck: «Wenn die Schweiz diesen Weg verfolgt, muss sie Risikogruppen speziell schützen»
Der Virologe Hendrik Streeck gehört seit Beginn der Coronakrise zu den wichtigsten Stimmen in Deutschland. Der 43-jährige Forscher plädiert seit Monaten dafür, vor allem Risikogruppen und ältere Menschen vor dem Virus zu schützen. Dass man jetzt nicht besser für den Winter gerüstet sei, liege an den Fehlern des vergangenen Sommers, sagt er im Gespräch dieser Redaktion.
Herr Streeck, pünktlich zum Weihnachtsfest geht fast ganz Europa wieder in den Lockdown. Wäre das zu vermeiden gewesen?
Hendrik Streeck: Die Infektionszahlen sind viel zu hoch. Ob ein anderer Weg möglich gewesen wäre, ist die 100-Millionen-Dollar-Frage. Was der Lockdown-Light in Deutschland gezeigt hat, ist, dass wir eine Reduktion der Infektionen bei den jüngeren Menschen erreichen, nicht aber bei den älteren. Wir haben weiterhin vor allem die Ausbreitung in den Alters- und Pflegeheimen. Ich bedaure, dass man nicht gezielter in den Schutz der Älteren und Kranken investiert. Und: Wir müssen endlich eine Langzeitstrategie entwickeln.
Wie könnte eine Langzeitstrategie denn aussehen?
Corona ist ein Marathon. Auch wenn der Impfstoff nun kommt und gut zu wirken scheint, ist er nur ein Baustein von vielen in unserem Kampf. Es ist nicht zu erwarten, dass wir innerhalb von wenigen Monaten so viele Menschen geimpft haben, dass sich das Virus nicht mehr weiter ausbreiten kann. Das heisst, wir müssen neben den tagesaktuellen Massnahmen die Notwendigkeit einer Langzeitstrategie real angehen.
Legen Sie los!
An oberster Stelle steht für mich die Frage, für wen dieses Virus vor allem gefährlich ist. Auch wenn es immer wieder auch bei Jüngeren zu schweren Verläufen kommt, zeigen die Daten eindeutig, dass Corona vor allem für alte Menschen und jene mit Vorerkrankungen eine Gefahr darstellt. In Deutschland sehen wir, dass zwei Drittel der Todesfälle in Altersheimen vorkommen. Hier kann man sehr konkret dagegen vorgehen, in dem man etwa dafür sorgt, dass Mitarbeiter von Alters- und Pflegeheimen täglich vor Betreten der Gebäude getestet werden. Zudem braucht es Antigen-Schnelltests für die Besucher, Schleusen, FFP-2-Maskenpflicht, Pooltestung und und und.
Soll man die Risikogruppe isolieren?
Ich spreche nicht von Wegsperren einer ganzen Generation. Wir müssen für die Risikogruppe ein möglichst gefahrenfreies Leben ermöglichen und sicherstellen, dass auch Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen ihre Angehörigen sehen können. Hier kann man pragmatisch und kreativ sein.
Wenn man den Fokus auf die Risikogruppe und die Altersheime legen würde, könnte man dann Theater, Kinos, Kneipen und Sportstätten geöffnet lassen?
Wir haben über den Sommer versäumt, diese Langzeitstrategie zu entwickeln oder wenigstens zu diskutieren. Ich hätte mir gewünscht, dass wir Dinge ausprobieren. Das ist kein Experimentieren am Menschen, sondern es wäre zu testen gewesen, wo das Virus in welcher Grössenordnung übertragen wird und wo nicht. Gab es denn Übertragungen in Kinos und in Gaststätten mit guten Hygienekonzepten? Wir wissen immer noch nicht, ob diese Hygienekonzepte funktionierten. Bei den aktuell hohen Infektionszahlen können wir so etwas natürlich nicht mehr machen, dafür ist es zu spät. Jetzt wäre es zu riskant, Theater, Kinos und Restaurants einfach zu öffnen.

Schnelltests statt Drinks: In Frankfurt hat man leerstehende Beizen zu Testzentren umgenutzt. Doch wäre die Schliessung wirklich nötig gewesen? © Keystone
Finden Sie die Strategie der Schweiz besser, die trotz hoher Infektionszahlen bislang den Lockdown verhindern will und zum Beispiel Cafés und Skigebiete noch immer offen hält?
Wenn die Schweiz diesen liberaleren Weg weiterhin verfolgt, muss sie meiner Meinung nach die Risikogruppen speziell schützen. Ansonsten hielte ich das für einen gravierenden Fehler, weil das zu einer schweren Belastung des Gesundheitssystems und damit zu Todesfällen führen kann, die man hätte verhindern können.
Auch in der Schweiz mehren sich die Stimmen, die einen Lockdown fordern. Kann nach einem kompletten Herunterfahren des öffentlichen Lebens im Januar wieder so etwas wie Normalität hergestellt werden?
Nein. Mitte Januar herrscht nicht einfach Normalität wie vor der Pandemie. Das Virus wird durch einen Lockdown nicht verschwinden. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir jetzt darüber reden, wie wir nach dem Lockdown weiter mit dem Virus umgehen wollen. Die Perspektive, dass nach dem Lockdown vor dem Lockdown ist, oder aber dass wir in eine Art Dauerlockdown bis April gehen, ist mir zu eindimensional.
Was würden Sie vorschlagen?
Neben diesem speziellen Schutz der Alters- und Pflegeheime könnte man etwa Shuttle-Busse für ältere Menschen einrichten, die zum Arzt oder zum Einkaufen fahren und somit nicht die öffentlichen Verkehrsmitteln benutzen müssen. Auch Bezugspersonen von Menschen aus der Risikogruppe sollen regelmässig getestet werden. Wir können das Infektionsgeschehen nicht alleine an den Infektionszahlen festmachen. Wir müssen ja davon ausgehen, dass die effektiven Infektionszahlen weit höher sind als bekannt. Wir müssen dort ansetzen, wo die Gefahren am grössten sind. Im Sommer, als die Infektionszahlen gering waren, hätten wir die Möglichkeit gehabt, jeden Kontakt nachzuvollziehen.
Hat man im Sommer eine Chance verpasst?
Es hätte seinen Charme gehabt, bei den geringen Ansteckungsraten im Sommer in einen Lockdown zu gehen, um die Chance zu haben, jeder Infektion auf den Grund zu gehen. Diese Diskussion gab es aber nicht. Ich habe für einen anderen Weg plädiert, der aber auch nicht aufgegriffen wurde; nämlich den Sommer dafür zu nutzen, Konzepte zu erarbeiten und zu probieren. Jetzt sind wir allerdings in einer Lage, in der es vor allem darum geht, die Infektionszahlen zu senken.
Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, dass sich möglichst zwei Drittel der Menschen impfen lassen, um das Virus auszubremsen.
Die Impfung wird eines von vielen Werkzeugen sein, das uns durch diese Pandemie bringen wird. Aber eine Pandemie wird am Ende – so hart das klingt – von uns allen bestimmt, da spielt die Impfung nur eine von mehreren Rollen. Der Epidemiologe Klaus Stöhr hat es drastisch formuliert: «Die Pandemie wird durch das Virus beendet.»
Nämlich dann, wenn das Virus nicht mehr genug Menschen findet, um sich weiter auszubreiten – weil so viele Menschen eine Immunität entwickelt haben, sei es durch Infektion oder Impfung. Corona besiegen wir durch die Kombination aus Impfung und Immunität.

Virologe Hendrick Streeck in seinem Bonner Labor: «Corona besiegen wir durch die Kombination aus Impfung und Immunität.»
© Keystone
Wann ist dieser Spuk mit Corona vorbei?
Ich weiss es leider nicht. Wir kennen heute vier heimische Coronaviren und es gibt keinen Grund, weshalb sich das neue Coronavirus nicht auch so verhalten sollte. Das heisst: Wir sehen bei Corona im Herbst und Winter einen Anstieg der Infektionszahlen, im März und April kommt es zu einer leichten Abflachung bis hin zu einem niedrigen Level in den Sommermonaten. Aber dann werden die Infektionen im Oktober und November wieder hochschiessen.
Sie rechnen damit, dass wir in einem Jahr wieder in der gleichen Situation sind wie jetzt?
Es ist wahrscheinlich, dass uns Corona noch eine lange Zeit beschäftigen wird. Allerdings, je mehr jetzt geimpft wird, desto weniger wird Corona unser Leben im nächsten Herbst bestimmen.
Über Corona gibt es verschiedene Theorien.
Wie ansteckend sind nun eigentlich Kinder?
Bei Kindern ist die Forschung schwieriger – alleine wegen der schnellen physischen Veränderungen. Das Grundwissen, das wir gewonnen haben, ist, dass Kinder bis 12 Jahre wahrscheinlich nicht so infektiös sind wie Erwachsene und sich nicht so leicht infizieren können. Sobald sie in die Pubertät kommen, ist es viel schwerer, die Risiken abzuschätzen.
Wie steht es um die Immunität, wenn ich Corona durchgemacht habe? Kann ich mich wieder anstecken?
Auch hierzu wissen wir noch wenig. Wir können auch hier wieder auf die vier heimischen Coronaviren schliessen. Dann wissen wir, dass eine Immunität zwischen sechs und 18 Monaten anhält. Nach jeder weiteren Ansteckung mit Corona ist danach aber mit milderen Verläufen zu rechnen.
Viele haben Angst, sich mit Corona zu infizieren. Das liegt auch an den Horrormeldungen der letzten 10 Monate. Setzt die Politik in der Kommunikation zu sehr auf den Angst-Faktor?
Angst und Panik können kurzfristig dazu führen, dass sich die Menschen über eine gewisse Phase am Riemen reissen. Aber die Angst lässt irgendwann nach. Angst kann in einem Sprint funktionieren, nicht aber in einem Marathon. Ein Belohnungssystem funktioniert über längere Phasen besser.
Eine Belohnung etwa wäre eine Perspektive, wann es wieder aufwärts geht.
Richtig. Man muss uns auch Ausblicke geben, die jenseits von Schliessungen und Warnungen sind. Ich bin überzeugt, dass Theater und Restaurants am Ende besser mit der Situation umgehen könnten, wenn man ihnen sagt, dass sie bis April schliessen müssen – als jetzt, wo wir uns von Lockdown zu Lockdown hangeln.
Um Kneipen, Theater oder Sportstätten schneller wieder zu öffnen, könnten die Geimpften Privilegien gegenüber den Ungeimpften bekommen. Was halten Sie davon?
Das ist eine sehr gefährliche Debatte, mit er sich aus meiner Sicht der Ethikrat auseinandersetzen muss. Es gibt Menschen, die nicht geimpft werden können, weil sie einfach ein zu schwaches Immunsystem haben. Privilegien für die einen bedeuten Diskriminierung für andere, das darf meiner Ansicht nach nicht passieren.

Ein Mann in Arizona lässt sich am 16. Dezember gegen Corona mit einem Präparat der Firma Biontech impfen.
© Ross D. Franklin / AP
Sind Sie selbst skeptisch, was den Impfstoff anbelangt, da Langzeitfolgen nicht erforscht sind?
Ich kann die Sorge der Menschen sehr gut nachvollziehen, aber ich selbst teile sie schon berufsbedingt nicht. Die Geschwindigkeit der Impfstoffentwicklung war hoch, die Erfahrung mit dem Impfstoff ist dementsprechend noch gering. Daher ist hier umso wichtiger, transparent und permanent zu kommunizieren, wie erfolgreich die Impfungen sind.
Die Debatte um Corona polarisiert die Gesellschaft. Wie haben Sie die letzten zehn Monate erlebt?
Ich habe aus der Ecke der Querdenker Morddrohungen erhalten und durfte insgesamt lernen, wie aggressiv manche Mandatsträger auftreten. Ich bedaure es daher umso mehr, dass wir es als Gesellschaft versäumt haben, überhaupt eine vernünftige Debatte um Corona und die Massnahmen zuzulassen. So wurden viele Äusserungen und Haltungen auf «gut» oder «schlecht» verkürzt. Wissenschaft ist nicht allwissend, da ist vieles Hypothese, die sich am Ende bewahrheitet oder nicht. Es gibt verschiedene Wege, auf Corona zu reagieren. In der Coronakrise hat die Politik die Wissenschaft so dargestellt, als verkündige diese die einzige Wahrheit – dabei können zwei oder mehrere Wahrheiten nebeneinander existieren. Es wäre gut gewesen, hätte man in der Debatte mehrere Meinungen zusammengeführt. Und: Es wäre ausserdem gut gewesen, in die Debatte ebenso die Expertise von Philosophen, Psychologen, Soziologen, Kinderärzten oder Verfassungsrichtern einzubeziehen.





