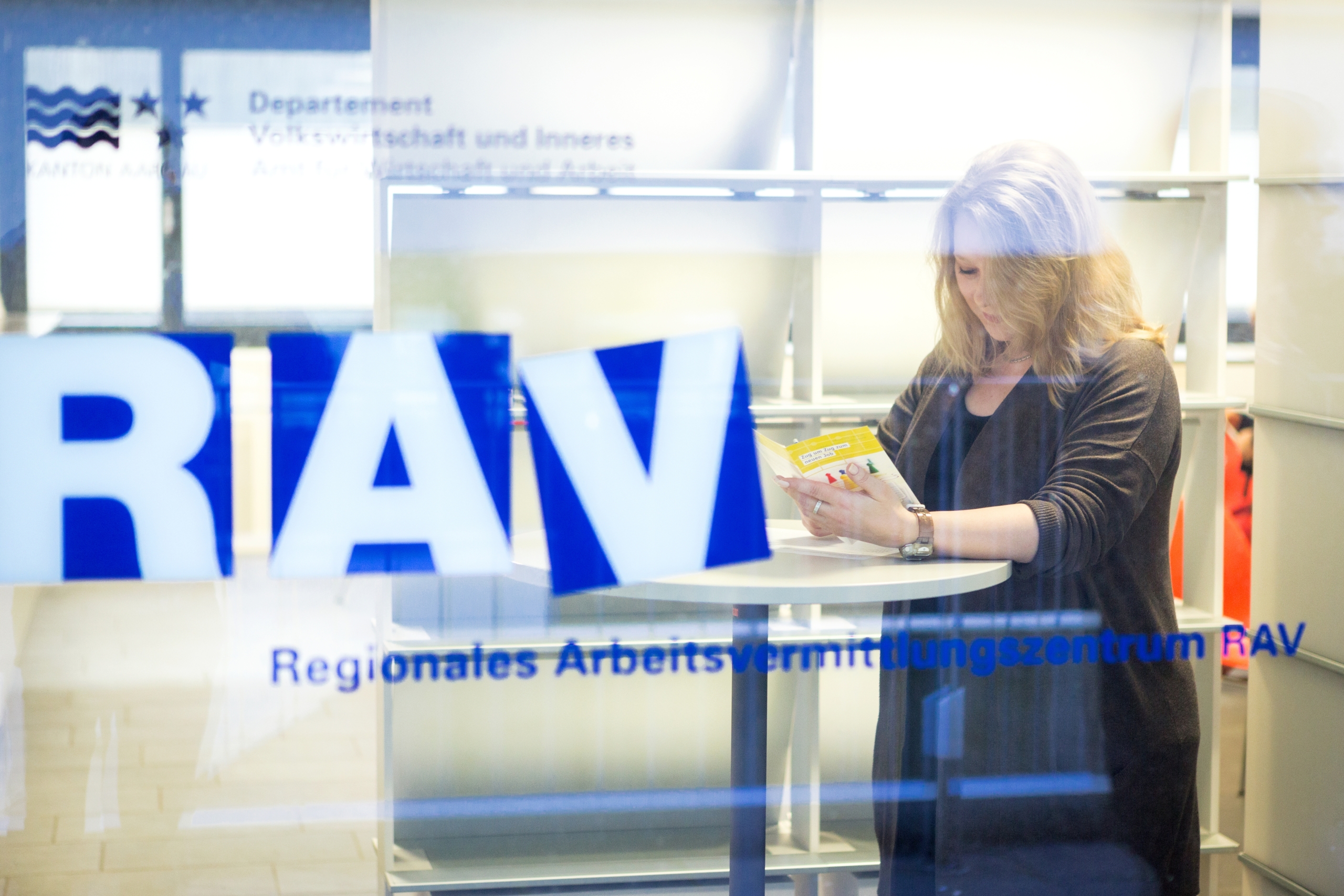Wanderimker sind in der Region äusserst rar
Weil rund 80 Prozent aller einheimischen Blüten von der Honigbiene bestäubt werden, spielt diese eine zentrale ökologische Rolle. Und die restlichen 20 Prozent der Blüten? Sie werden von Hummeln, Wildbienen, Wespen und Schmetterlingen bestäubt – wobei diese im Vergleich zur Biene häufig auf eine Blütenart spezialisiert sind.
Die Honigbiene ist somit hauptverantwortlich für gute Ernten und Artenvielfalt. Umso mehr schreckt es die Landwirte auf, wenn sie in der Fachpresse immer wieder von grossen Verlusten von Bienenvölkern lesen müssen. Zum einen gehen diese auf das Konto der Varroamilbe, zum anderen werden die Verluste dem sogenannten Colony Collapse Disorder (CDD) zugeordnet. Beim CDD verschwinden über die Winterphase die Arbeiterinnen aus bisher ungeklärten Gründen und lassen die Königin, die Brut und auch Nahrung zurück, was in der Folge zum Aussterben des betroffenen Volks führt.
Im Kanton Aargau haben Bauern und Imker bereits 2019 reagiert und das Projekt «bienenfreundliche Landwirtschaft» ins Leben gerufen. Die Landwirte setzen in dessen Rahmen verschiedene honig- und wildbienenfreundliche Massnahmen um – richten unter anderem Nistmöglichkeiten für Wildbienen mit Totholz, Kopfweiden, offenem Boden oder Sandhaufen ein.
Landwirt sucht Wanderimker
Was zudem gesucht ist, sind Wanderimker – Bienenzüchter, die mit ihren Völkern zu den Kulturen der Bauern ziehen. Denn Bienen sind vor Ort längst nicht mehr flächendeckend in ausreichender Zahl vorhanden.
Wie steht es in der Region um die Wanderimkerei? Susanne Scheibler ist Präsidentin der Wiggertaler Bienenzüchter: «Das ist bei uns kein grosses Thema.» Der Grund? «Die Wanderimkerei ist sehr aufwändig und man benötigt ein geeignetes Fahrzeug.»
Einen Wanderimkerei gibt es dennoch: jene von Hans Burkhard in Rothrist. «Ich bin in der dritten Generation Wanderimker», sagt er. Zwischen 120 bis 150 Bienenvölker nennt er sein Eigen und bringt das eine oder andere beispielsweise zu einem Rapsfeld. «Wanderimkerei ist ein Geben und Nehmen – ich bekomme den Honig, der Landwirt eine befruchtete Kultur.»
Heikel sei vor dem Hintergrund des Feuerbrands – eine gefährliche Bakterienkrankheit, die an Apfel-, Birn- und Quittenbäumen grosse Schäden anrichtet – das «Verstellen», das Umplatzieren eines Bienenstocks im Bereich von Obstanlagen. Da müsse man aufpassen.
Wer sich vertieft mit dem Thema Bienen befassen will, dem bietet der Wiggertaler Bienenzüchterverein eine Patenschaft an. Diese soll – so das Ziel – den Kontakt zwischen Imkern und interessierten Personen fördern. Im Patenschaftsbeitrag enthalten sind vier Kilo Honig aus dem mit Patennamen versehenen Bienenstock. Details dazu findet man unter «Wiggertaler Bienenzüchterverein» im Internet. (bkr)