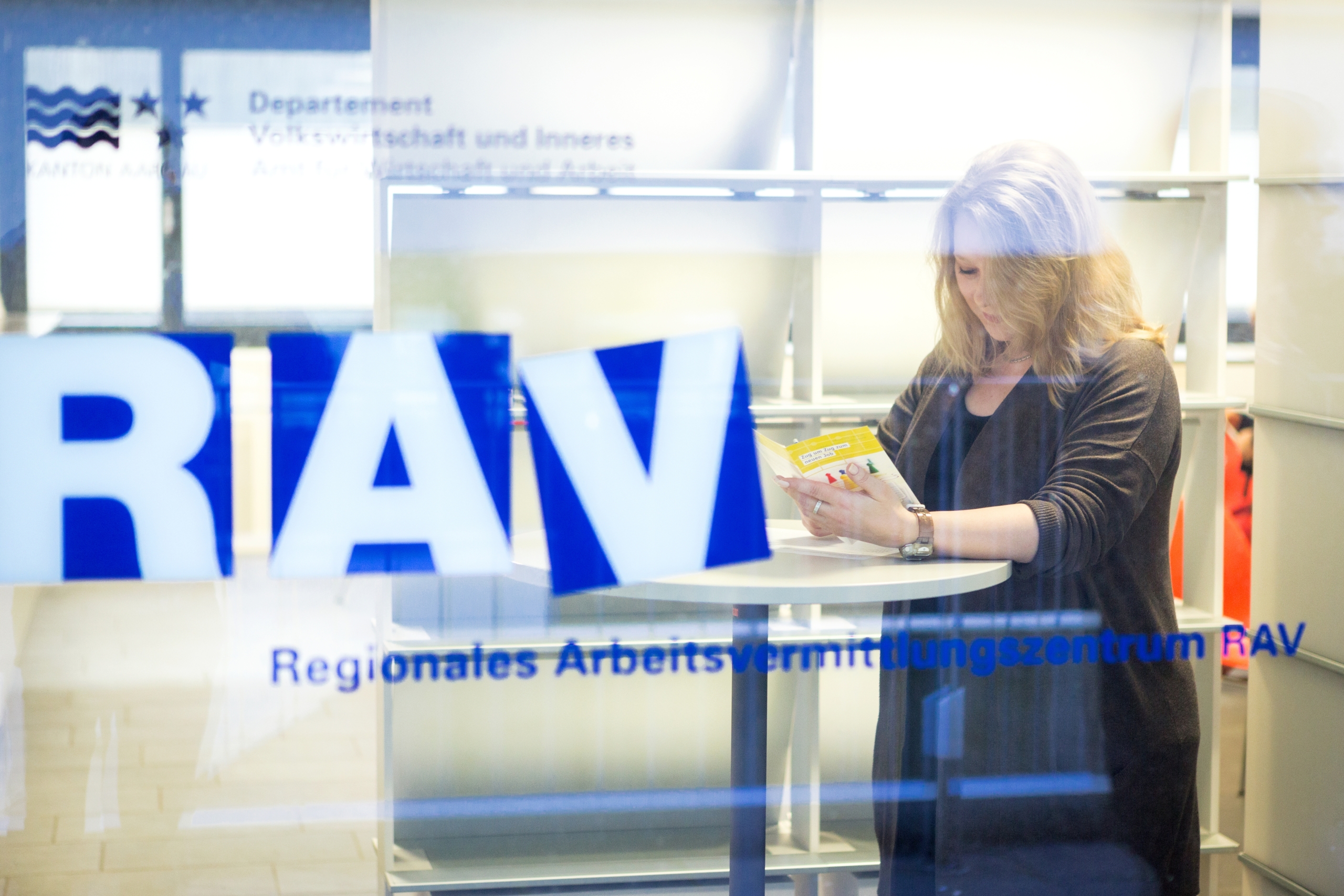Warum die Gemeindeversammlung zum Event werden soll
Aarburg und Oftringen fallen bei nationalen und lokalen Abstimmungen sowie Wahlen regelmässig mit einer tiefen Stimmbeteiligung auf. Bei der Wahl des Gemeindeammanns beteiligten sich Ende September in Aarburg immerhin 31,7 Prozent, bei der Wahl zum Vizeammann 30,5 Prozent. In Oftringen lag die Stimmbeteiligung beim Gemeindeammann bei 24,8 Prozent und beim Vizeammann bei 24,3 Prozent.
Warum das so ist, erklärt der Aarburger Gemeindeammann Hans-Ulrich Schär unter anderem mit dem überdurchschnittlichen Wechsel der Bevölkerung. Aarburg habe viele Zu- und Wegzüge pro Jahr. «Da scheint man sich für die lokale Politik nicht so sehr zu interessieren.» Auch die Ortsparteien würden mit diesem Phänomen kämpfen. «Kaum jemand interessiert sich für eine Mitgliedschaft, egal welcher Couleur.» Ähnlich sieht es Schärs Oftringer Amtskollege Hanspeter Schläfli: «Oftringen ist leider seit Jahren für die tiefe Stimmbeteiligung bekannt. Die heutige Mobilität mit teilweise raschen Wohnortswechseln fördert die Verbundenheit auch nicht.» Diese entwickle sich erst im Laufe der Zeit, «vor allem, wenn man von weit her zuzieht». Zudem habe Oftringen im Vergleich zum Beispiel zu Zofingen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung viel weniger Arbeitsplätze, was darauf schliessen lasse, dass aufgrund der zentralen Lage und der guten Verbindungen Oftringen als Wohnort gewählt wurde, um von hier aus einen Arbeitsplatz zu erreichen.
Um die Menschen in den politischen Prozess einzubinden, hat der Oftringer Gemeinderat diesen Herbst eine auf die Gemeindeversammlung ausgerichtete Kampagne begonnen «und wird diese im Rahmen seiner Möglichkeiten weiter ausbauen», so Schläfli. In Aarburg organisiert die Gemeinde – «wo immer möglich» – Infoveranstaltungen zu interessanten Geschäften durch. «Um Schwellen abzubauen, wurde die Mitwirkung bei der Bau- und Nutzungsordnung digitalisiert», sagt Schär. Auch werde die Gemeinde an der Gewerbeausstellung Messe an der Aare (MADA) 2022 einen Stand führen. Er meint aber: «Wenn es um ein Thema geht, das die Leute beschäftigt, dann bringen sie sich ein.» Das habe die Abstimmung über den Fortbestand der Bibliothek deutlich gemacht.
Zweifel an Stimmrechtsalter 16 und Ausländerstimmrecht
Schär bezweifelt, dass die Einführung von Stimmrechtsalter 16 und dem Stimmrecht für die ausländische Bevölkerung eine positive Auswirkung auf die Stimmbeteiligung hätten. Die Partizipation bei den Jungbürgerfeiern sei beispielsweise sehr gering. «Leider musste aufgrund des mangelnden Interesses dieser Anlass in Aarburg trotz interessantem Programm gestrichen werden», fügt er an. Auch beim Ausländerstimmrecht zeigt er sich skeptisch. «Dadurch würde die Stimmbeteiligung noch kleiner», glaubt er. «Ich gehe davon aus, dass sich ca. zehn bis zwanzig Prozent bei lokalen Abstimmungen oder an der Gemeindeversammlung beteiligen würden. Jene, denen die Beteiligung sehr wichtig ist, lassen sich einbürgern. Dies wird sehr oft als Begründung bei den Einbürgerungsgesprächen ins Feld geführt.»
Hanspeter Schläfli äussert sich ebenfalls eher skeptisch zum Stimmrechtsalter 16: «Grundsätzlich sind Personen mit 16 Jahren heute weiter als vor einigen Jahrzehnten. Ich bin aber nicht überzeugt, dass das die Stimmbeteiligung in Prozenten dadurch erhöht.» Vielmehr solle in der Schule dem Fach Staatskunde wieder vermehrt Beachtung geschenkt werden. «Die politischen Prozesse sind spannend und tragen viel zum Verständnis der Gesellschaft bei.» Kritisch äussert sich Schläfli zum Ausländerstimmrecht: «Viele Personen aus dem Ausland ziehen in die Schweiz, weil sie hier Arbeit finden. Die Beteiligung an politischen Prozessen steht bei ihnen ganz selten an erster Stelle.» Er ist überzeugt: «Je höher der aktuelle Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung in einer Gemeinde ist, desto tiefer käme die Stimmbeteiligung in Prozenten heraus.» Denn auch hier fehle wieder die Verbundenheit mit dem Wohnort.
Wissenschaftler nimmt Behörden und Parteien in Pflicht
Das ZT hat auch Politikwissenschaftler Urs Vögeli aus Zofingen bezüglich tiefer Stimmbeteiligung kontaktiert. Er sagt: «Eine tiefe Wahlbeteiligung ist nicht per se ein Problem. Denn wer nicht abstimmen und wählen geht, akzeptiert die Wahl der anderen.» Die Gründe für die tiefe Beteiligung ortet er unter anderem darin, dass es jährlich viele verschiedene Wahlen und Abstimmungen gibt. Der Anreiz, an die Urne zu gehen, sei dann geringer, denn man könne sich die Themen auswählen. «Das ist die polit-philosophische oder normative Antwort auf diese Frage», sagt Vögeli. Zudem würden sich die Medien- und Politwelt hauptsächlich um die nationalen Abstimmungen und Themen kümmern. «Medien sollten sich vermehrt um Lokales kümmern», sagt Vögeli. Als weiteren Grund führt er die Unterschiede zwischen Zentrum, Agglomeration und Land an. «Es ist kein Stadt-Land-Graben», sagt er. Es seien vor allem die Agglomerationsgemeinden wie Aarburg und Oftringen, die mit ihrer Identität kämpfen. Zofingen beispielsweise sehe sich klar als Zentrum. «Da ist ein anderes Selbstverständnis vorhanden», erklärt Vögeli. «In den Agglomerationsgemeinden fehlt häufig das Community-Building.» Das beginne damit, dass die Vereine, die sonst gute Integrationsarbeit leisten – nicht nur von der ausländischen Bevölkerung, sondern auch bei Neuzuzügern –, ebenfalls Mitgliederschwund beklagen.
Vögeli nimmt aber auch Parteien und Behörden in die Pflicht. «Sie müssen kreativer werden und sich etwas von der Start-up-Kultur inspirieren lassen», sagt er. «Schneller mal etwas ausprobieren und wagen oder sich auch die digitalen Medien zunutze machen, beispielsweise einen Blog starten.» Zudem müssen sich Parteien und Behörden wieder nach draussen zu den Menschen begeben. Herkömmliche Veranstaltungen würden nicht mehr reichen. «Im 21. Jahrhundert gelingt es nicht mehr, die Menschen zu sich zu holen. Man muss zu ihnen gehen, raus in die Quartiere, ins Kleinteilige», sagt Vögeli. Dabei spricht er auch von einer Gemeindeversammlung 4.0. Gemäss dieser Idee soll die Gemeindeversammlung zu einem Event werden, an dem sich auch Vereine beteiligen. «Ja, das ist eine Herausforderung für die Behörden. Häufig verstecken sie sich aber auch dahinter», konstatiert der Politikwissenschaftler. Gemeinden wie Aarburg und Oftringen stehen also vor der Aufgabe, ihren Kommunen eine Identität zu geben, damit diese gesellschaftlich und politisch nicht zu Schlafstädten werden.