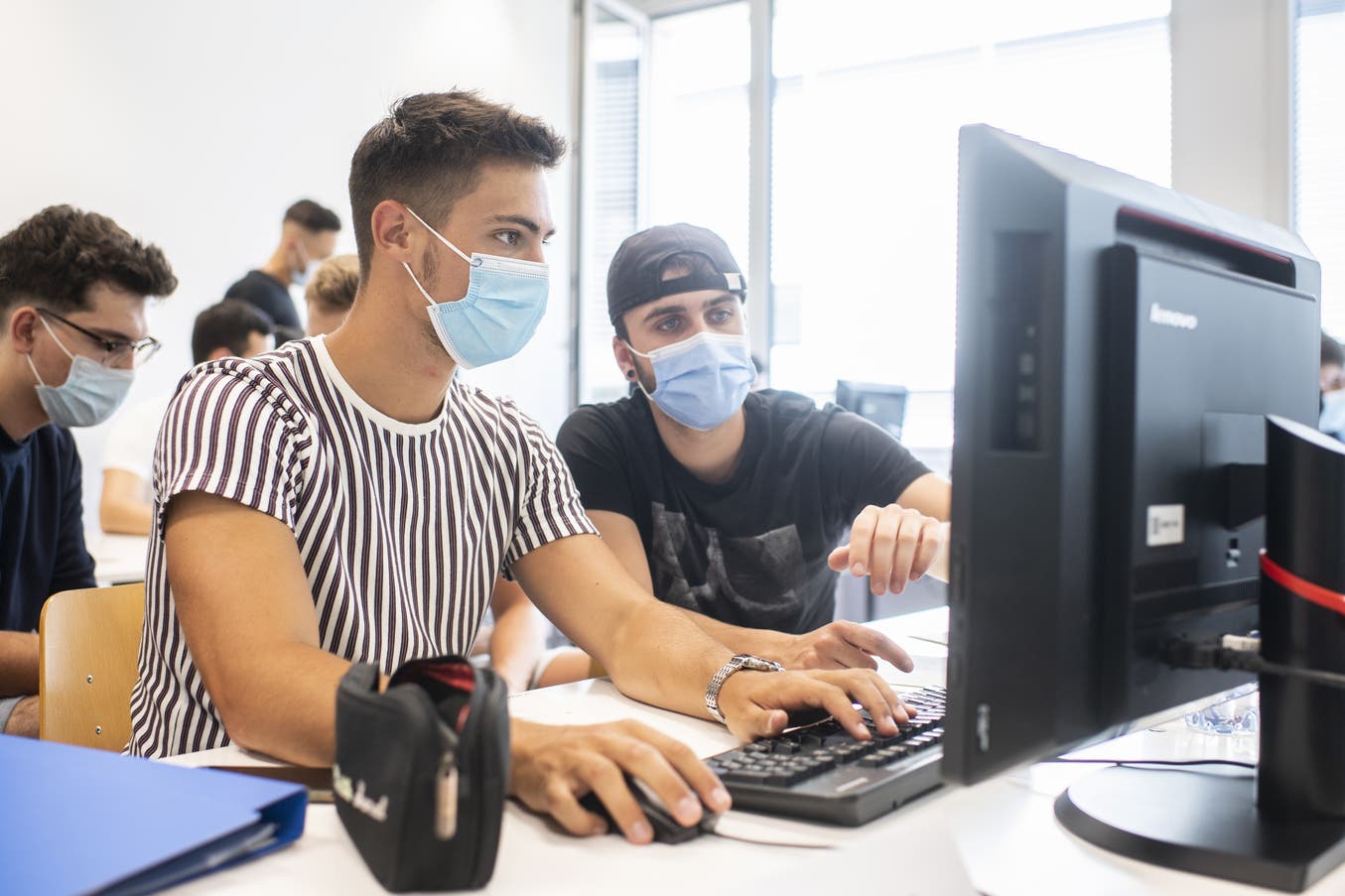
Was heisst eigentlich «Mit dem Virus leben»?
Oft wird behauptet, man müsse «mit dem Virus leben lernen». Meist als Alternative zu Massnahmen, die man als übertrieben und unnötig erachtet. Oft wird aber nicht ganz klar gemacht, was das bedeutet. Denn: «Leben und leben lassen» – das funktioniert mit den meisten Krankheitserregern nicht.
So wäre es vielleicht gut, wenn man sich ein Bild machen könnte, wie dieses «Leben mit SarsCoV-2» aussehen könnte.
Der Epidemiologe Adam Kucharski schrieb das Buch «The Rules of Contagion – Why Things Spread And Why They Stop» (2020; mittlerweile auch auf Deutsch ) – obwohl es perfekt in die Landschaft passt, kein opportunisitischer Schnellschuss –, in dem er zeigt, dass die Verbreitung von Viren, Bakterien und anderen Krankheitserregern Regeln folgt, die mathematisch modelliert werden können. Und diese Regeln gelten nicht nur für krankheitserregende Mikroorganismen, sondern sind eher Gesetze der Gesellschaft. Denn wie sich Dinge innerhalb einer Gesellschaft verbreiten, sagt mehr über sie aus als über diese Dinge selbst. Kucharski, der in der Jugend vom Guillain-Barré-Syndrom befallen war, einer gefährlichen Autoimmunerkrankung, die ähnliche Symptome wie Polio auslöst, beginnt mit Ronald Ross, der dem Malaria-Erreger nachspürte und die Disziplin der mathematisch inspirierten Epidemiologie begründete, landet dann aber bald bei der Finanzwirtschaft und den Medien.
Die Grundform der Verbreitung wird klar in einer Kurve, die wie ein lang nach vorne gestrecktes «S» aussieht. Es beginnt flach, steigt dann mehr oder weniger steil an und endet mit einer Abflachung und schliesslich in einem Plateau.
Die S-Kurve
Das Bild ist uns mittlerweile vertraut. Das Plateau, wo die Infektion stockt und schliesslich stoppt, nennen wir «Herdenimmunität». Das heisst: Es müssen nicht alle Mitglieder einer Population die Infektion durchgemacht haben. Pandemien können auch in Wellen auftreten, dann wiederholt sich die Bewegung von Anstieg und Senkung/Abflachung einfach jeweils wieder.
Das einfache Modell, das die Kurve abbildet, heisst abgekürzt SIR (Susceptible – Infected – Removed), es beschreibt die Veränderung der Verteilung von «Empfänglichen» (Ungeschützten), «Infizierten» (Angesteckten und Ansteckenden) und «Entfernten» (Personen, die aus dem Prozess ausgeschieden sind, weil sie wieder gesund und immun geworden oder gestorben sind; Geimpfte fallen natürlich auch darunter). Die Generalthese ist: Solange sich ausreichend «S»-Elemente in einer Population finden, steigt die Kurve. Das gilt auch für Betrugsmuster in der Finanzwelt: Sogenannte «Ponzi»-(Schneeball-)Modelle funktionieren, solange neue «Dumme» beitreten und die Mitglieder, die schon drin sind, auszahlen, läuft das Ding.
Und DOTS – die entscheidenden Punkte
Kucharski liefert in seinem Buch aber auch den anderen entscheidenden Beitrag, den es braucht, um Pandemien zu verstehen: Er nennt es D.O.T.S. Die Abkürzungen stehen für «duration of infection» (wie lange ein Angesteckter andere anstecken kann); «opportunities for transmission» (die Zahl der Gelegenheiten, die das Virus hat, um einen anderen Wirt zu befallen, also die Kontakte), «transmission probability« (die Wahrscheinlichkeit der Infektion während eines Kontakts) und «susceptibility» (die Zahl der noch Empfänglichen in einer Population). Das sind die vier Faktoren, welche in der Reproduktionszahl «R» stecken.
«D» und «T» bleiben während einer Pandemie eher unverändert, ausser das Virus mutiert und seine Biologie ändert sich, «O» und «S» sind prinzipiell steuerbar und sollten abnehmen, wenn die Pandemie zum Halten kommen soll.
Man kann fünf Szenarien unterscheiden, wie man eine Pandemie stoppen und «mit dem Virus leben» kann. Welche geeignet ist, hängt nur zu einem Teil vom Virus ab, sondern fast ebenso stark von gesellschaftlichen Entscheidungen.
Fünf Szenarien, wie eine Gesellschaft mit einem Erreger umgehen kann, der Epidemie-Potenzial hat
- Kontrolle: Reduktion des Auftretens einer Krankheit/eines Erregers auf ein gesellschaftlich akzeptiertes Niveau. Es gibt Massnahmen, aber sie müssen nicht so weit gehen, um Inzidenz (Vorkommen von neuen Fällen), Prävalenz (das Vorkommen von Fällen) und sogar Sterblichkeit auf null zu senken. Man toleriert die Krankheit in einem gewissen Mass. Funktioniert gut bei wenig infektiösen Erregern, die mit Vorsichts- und allgemeinen Hygienemassnahmen in Schach gehalten werden können. Beispiel: Darm- und Durchfallerkrankungen wie Salmonelleninfektionen.
- Verhinderung der Krankheit: Die Erkrankung sollte in einem definierten räumlichen Areal nicht mehr vorkommen. Dafür sind bestimmte, auch präventive Massnahmen nötig: Unter anderem obligatorische Impfung oder das Vorhandensein von bewährten Therapien. Beispiel: Tollwut, Starrkrampf.
- Verhinderung der Infektion: Verhinderung der Infektion durch einen bestimmten Erreger in einem definierten räumlichen Areal. Dafür sind – vor allem für hoch-infektiöse Erreger, welche die Atemwege befallen – neben präventivem Impfen auch ausgebaute Überwachungs- und Kontroll-Massnahmen nötig: Testen und Contact Tracing, um neue Fälle sofort zu erkennen und eingrenzen zu können, damit keine Neu-Ansteckungen stattfinden können. Beispiele: Masern, Polio.
- Ausrotten des Erregers: Das Auftreten des Erregers weltweit wird durch geeignete Massnahmen verhindert. Das ist einfacher, wenn der Wirt des Erregers der Mensch ist. Dann ist der Erreger verschwunden, wenn die Inzidenz weltweit null ist. Bei Erregern mit Zwischenwirten (zB Insekten oder Nagern) ist es schwieriger. Beispiel: Pocken.
- Auslöschen des Erregers: Der Erreger kommt weltweit nicht mehr mehr vor. Beispiel: Keines.
Bei Covid-19 gibt das Virus vor: Relativ hohe Infektiosität, Re-Infektion aus der Tierwelt (erneute Zoonosen) nicht ausgeschlossen, Sterblichkeit und Langzeitwirkungen sind nicht zu vernachlässigen. Die Szenarien 1 und 2 scheinen eher nicht geeignet. Wenn die saisonale Grippe ein Fall zwischen Szenario 1 und 2 ist, wäre Covid-19 wahrscheinlich eher einer zwischen 2 und 3.
Um Covid-19 in ein Szenario 3 – oder allenfalls ein erweitertes Szenario 2 – zu bringen, muss zuerst die Inzidenz auf praktisch null heruntergebracht werden (keine neuen Infektionen). Dann müssen institutionell Testen und Contact Tracing ausgebaut werden. Zwischen dem Auftreten eines neuen Falles und dem Verhängen von Massnahmen sollte möglichst keine Zeit vergehen: Das heisst Ausbrüche sofort energisch bekämpfen mit Abriegeln etc. Inwieweit Impfen und erworbene Immunität helfen, das Infektionsrisiko zu senken, wissen wir noch nicht genau. Re-Infektionen sind nicht ausgeschlossen.
Wahrscheinlich lässt sich Covid-19 nicht auf eine ähnliche Weise wie die jährliche Grippe behandeln (freiwillige Impfung und sonst fast keine Massnahmen ausser allgemeinen Empfehlungen). Also wird es – «seuchenmässig gesprochen» – nach Covid-19 keine vollständige «Rückkehr zur Normalität», zum Leben, wie es vorher war, geben. Aber es wird auch nicht der dauernde Ausnahmezustand sein.
Adam Kucharski: The Rules of Contagion. Why Things Spread and Why They Stop. Profile Books London 2020. – Deutsch: Das Gesetz der Ansteckung. Was Pandemien, Börsenchrashs und Fake News gemeinsam haben. Hirzel-Verlag Stuttgart 2020. Von Adam Kucharski gibt es auch: The Perfect Bet. How Science and Maths Are Taking the Luck Out of Gambling. Profile Books London 2016.





