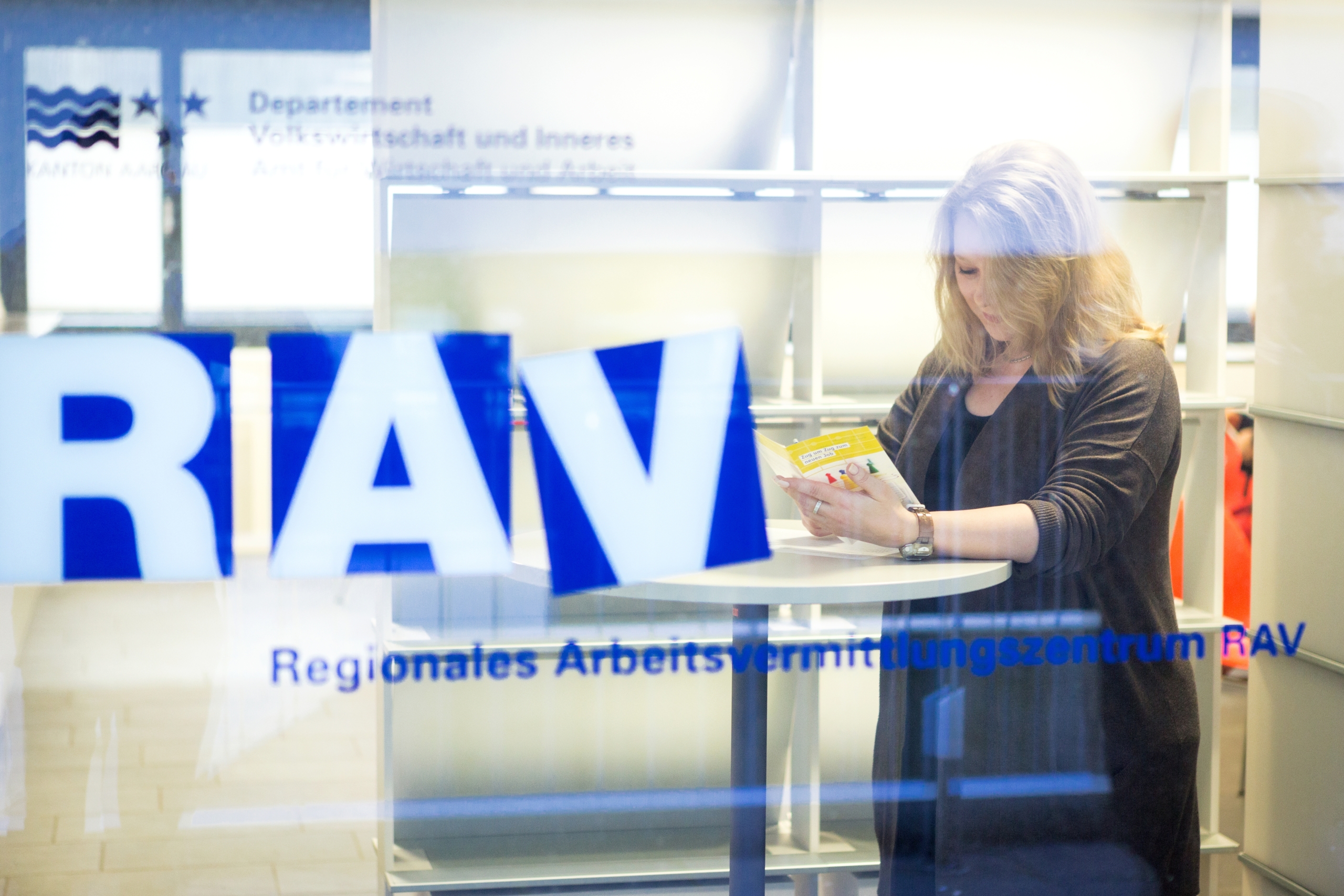«Wir prüfen laufend, ob wir Verbote verhängen»


Herr Laib, unser Interview findet zum Glück vormittags statt. Hier in Ihrem Büro unter dem Dach wird es jeweils sehr heiss. War es dieses Jahr besonders schlimm?
Ja, Sie haben Glück. Im Verlaufe des Tages wird es im Büro immer heisser. Wir hatten schon vor drei Jahren eine Hitzeperiode, dieses Jahr hält sie jedoch viel länger an. Auch wenn die Temperaturwerte tiefer sind als 2015, die Trockenheit und die Waldbrandgefahr sind viel grösser. Letztere wird in nächster Zeit zurückgehen. Die Trockenheit wird uns aber noch länger beschäftigen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, kommt mir eher das Gegenteil in den Sinn. Häufig war das Wetter im Sommer zu schlecht, um im See zu baden.
Hat sich die Waldbrandgefahr mittlerweile ein wenig entschärft?
Nein, die Waldbrandgefahr besteht immer noch. Mittlerweile hat der Kanton zwar das absolute Feuerverbot aufgehoben, die Gefahrenstufe fünf besteht aber immer noch. Solange es nicht einmal zwei oder drei Tage am Stück regnet, kann man diese nicht widerrufen. Die Wälder sind nach wie vor trocken. Die Situation bleibt heikel.
Sie haben sechs Tage vor dem Nationalfeiertag ein Feuerwerksverbot für 16 Gemeinden verhängt. Wie haben die Leute auf die Entscheidung des Regionalen Führungsorgans (RFO) reagiert, als bekannt wurde, dass es am ersten August kein Feuerwerk gibt?
Die Reaktionen variierten: Das Gros der Bevölkerung befürwortete die Entscheidung. Viele zeigten Verständnis für die schwierige Situation. Anders fiel die Reaktion bei Leuten aus, die schon Bewilligungen für grosse Feuerwerke bei den Gemeinden eingeholt hatten. Sie haben uns gebeten, Ausnahmen zu machen. Das haben wir jedoch abgelehnt. Wäre etwas passiert, hätten wir die Verantwortung nicht übernehmen können.
Das RFO hat wesentlich früher Massnahmen ergriffen als der Kanton, dieser hat das Feuerverbot erst am 30. Juli verhängt. Erachten Sie es als klug, erst 48 Stunden vor dem Nationalfeiertag ein Feuerverbot zu verhängen?
Das ist Ansichtssache. Der Kanton hatte es mit seiner Entscheidung nicht einfach. Er muss alle seine Gebiete berücksichtigen. Die Waldbrandgefahr war regional sehr unterschiedlich ausgeprägt: Die Städte waren nicht gross gefährdet, betroffen waren in erster Linie die ländlichen Gegenden. Das Timing des Verbots war natürlich unglücklich.
Bei den vielen verschiedenen Warnstufen, die regional variieren, verliert die Bevölkerung den Überblick. Müsste die Kommunikation optimiert werden?
Es besteht sicherlich Verbesserungsbedarf. Die Kommunikation ist alleine in den 16 Gemeinden des Suhren- und Uerkentals schon schwierig, geschweige denn im ganzen Kanton. Sobald nur die kleinste Vermutung besteht, dass die Gefahrenstufe erhöht wird, klingelt das Telefon. Die Bevölkerung und die Medien wollen sofort Bescheid wissen. Es besteht kaum Spielraum, um die Warnungen schön geordnet herauszugeben.
Welche konkreten Verbesserungen können sich vorstellen?
Im digitalen Zeitalter müsste es möglich sein, dass auf einer Plattform ersichtlich ist, welche Gemeinden Warnungen ausgesprochen haben. In unserer Region haben gewisse Gemeinden noch vor dem RFO entschieden, ein Feuer- und Feuerwerksverbot zu verhängen. Schöftland beispielsweise hat das Verbot schon zehn Tage vor dem RFO kommuniziert. Solche Details müssten an einem zentralen Ort übersichtlich dargestellt sein.
Also eine interaktive Landkarte im Internet?
Ja, das ist mein Wunsch. Es wäre super, wenn die Leute die verschiedenen Gemeinden auf einer solchen Karte ansteuern könnten und auf einen Blick ersichtlich ist, welche Warnungen, Empfehlungen oder Verbote herausgegeben sind.
Wann können wir wieder im Wald grillieren?
(lacht) Ich bin kein Hellseher. Das Einzige, was ich tun kann, ist die verschiedenen Wetterdienste zu konsultieren. Ich habe das Gefühl, dass das Feuerverbot noch eine ganze Weile bestehen bleibt. Bis Ende August erwarte ich keine Wetterumstürze. Die Grosswetterlage ist in ganz Europa dieselbe, auch unsere Nachbarländer haben mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. Ein Meteorologe sagte einst: «Wenn die Ostsee sechs Grad wärmer ist, ist das ein Zeichen für einen trockenen Herbst.» Das Laub, das wegen der Trockenheit jetzt schon von den Bäumen fällt, verstärkt die Waldbrandgefahr zusätzlich. Deswegen könnte das Feuerverbot noch bis Ende September bestehen bleiben. Ich gehe davon aus, dass die Warnstufe innerhalb der Siedlungen schon früher gesenkt werden kann. Nach zwei oder drei Tagen Regen sollte dies der Fall sein.
In Zusammenhang mit der Hitze ist aktuell der Klimawandel in aller Munde. Beunruhigen sie solche Extremwetterlagen diesbezüglich?
Sicher, man macht sich schon seine Gedanken. Wenn wir in Zukunft jeden Sommer eine solche Hitzeperiode haben, beunruhigt das. Im Winter ist die Situation eine ähnliche: Trotz des vielen Schnees vor einem halben Jahr haben die Gletscher massiv gelitten.
Wo müsste man sich in der Region mehr wappnen, wenn es in den nächsten Sommern unverändert so weiter geht?
In unserem Fokus sind der Grundwasserspiegel und die Quellen. Wir haben uns mit Brunnenmeistern beraten. Ihre Aussagen lassen aufhorchen. Erstaunlich ist, dass der Wasserverbrauch im Moment sehr hoch ist. Die Quellen haben wenig Zufluss, sie gehen kontinuierlich zurück. Der Grundwasserspiegel senkt sich stetig ab. Das kann nicht so weitergehen. In den nächsten Tagen und Wochen beurteilen wir laufend, ob und wie weit wir den Trinkwasserverbrauch einschränken müssen.
Wo zum Beispiel?
Es könnten Rasenbewässerungen oder Autowaschanlagen stillgelegt werden. Empfehlungen zum Wassersparen haben wir bereits veröffentlicht. Derzeit prüfen wir, ob wir allenfalls Verbote verhängen müssen. Diese haben einen ganz anderen Charakter als die Empfehlungen. Hält sich jemand nicht an die Verbote, hat das Konsequenzen. Deswegen muss gut überlegt sein, ob es sich lohnt, so restriktiv vorzugehen. Angesichts der aktuellen Situation können solche Massnahmen jedoch durchaus Sinn machen: Bis sich der Grundwasserspiegel und die Quellen erholen, ist eine Regenzeit von fünf bis acht Wochen nötig.
Langfristig betrachtet: Was wären Ihrer Meinung nach sinnvolle Massnahmen, um den Wasserverbrauch nachhaltig zu reduzieren?
Sollte das Wasser einmal ausserordentlich knapp werden, müsste man es kontingentieren. Wasser ist ein Menschenrecht. Es sollte niemandem verwehrt bleiben. Bevor es so weit ist, können wir aber noch einiges unternehmen. Ich denke dabei in erster Linie an die Grossverbraucher: Die Schliessung einer Badi wäre denkbar. In absehbarer Zeit wird eine Debatte darüber entstehen, auf welche Arten der Wassernutzung verzichtet werden kann. Wir jedoch noch nicht an diesem Punkt. Im Moment rufen wir zu Solidarität innerhalb der Bevölkerung auf. Es soll auf freier Basis Wasser gespart werden, damit für dringend Notwendiges, wie zum Beispiel die Nahrungsmittelproduktion, genug übrig bleibt. Sollten wir irgendwann rationieren müssen, wird die Lage schwierig. Das müsste überregional geregelt werden, dann käme sicher der Kanton ins Spiel.
Viele Leute wollen nach wie vor von einem Klimawandel nichts wissen. Wie entgegnen Sie dem, als jemand, der täglich mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert ist?
Man muss sich je länger je mehr mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Wir müssen unbedingt Sorge tragen zur Umwelt. Ich bin mir jedoch nicht sicher, inwieweit wir in Europa etwas zum Erhalt des Klimas beitragen können. Nichtsdestotrotz sollte sich jeder Gedanken darüber machen, was er für die Umwelt tun kann. Ich muss in diesem Zusammenhang immer an Folgendes denken: Wer kann es sich schon leisten, mit Trinkwasser die Toilette zu spülen? Ich finde das wahnsinnig.
«Die Leute lernen erst aus grossen Katastrophen», sagte der Klimaexperte Martin Grosjean kürzlich in einem Interview. Deshalb werde in unmittelbarer Zukunft noch nichts Handfestes gegen den Klimawandel unternommen. Teilen Sie diese Meinung?
Das würde ich unterschreiben. Genau das habe ich auch in unserer Region beobachtet: Zwar halten sich viele Leute an die Verhaltensempfehlungen und sparen Wasser; leider gibt es jedoch auch die anderen. Das Motto lautet häufig: «Ich zahle das Wasser, also brauche ich es auch.» Dieser Egoismus bleibt bestehen, solange keine finanziellen Anreize oder Verbote bestehen.
Sie glauben, dass es noch einige extreme Trockenheiten geben muss, bis die Toiletten nicht mehr mit Trinkwasser gespült werden?
Ja. Die Leute brauchen Anreize, um auf umweltfreundliche Systeme umzustellen. Sind keine Anreize gegeben, engagieren sich nur Leute, die aus Überzeugung etwas für die Umwelt unternehmen wollen.
Sensibilisieren Sie Ihr Umfeld, Ihre Familie für dieses Thema?
Ja. Den Rasen tränken wir zuhause nicht mehr. Wir versuchen, uns einzuschränken und nur das Nötigste an Wasser zu verbrauchen. Wichtig ist, dass die Lebensmittelproduktion genug Wasser hat.
Sie haben bezüglich des Wassersparens eine Vorbildfunktion.
Das stimmt. Vorbildhaftes Verhalten erwarte ich auch von den politischen Würdeträgern. Gehen diese mit beispielhaftem Verhalten voran, können sie etwas bewirken.
Welche Botschaft bezüglich des Wassers möchten sie der Bevölkerung ans Herz legen?
Der Umgang mit dem Wasser muss viel bewusster werden. Wir müssen unseren Wasserverbrauch stetig hinterfragen. Das Thema Wasser wird so schnell nicht wieder verschwinden.