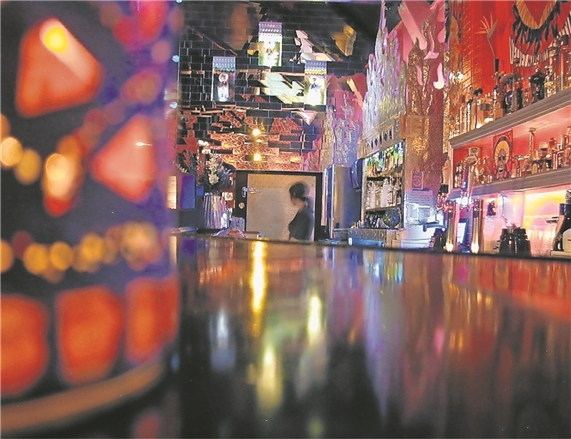
Der Kanton verstärkt den Kampf gegen den Menschenhandel
MENSCHENHANDEL
Was können Freier tun?
In der Prostitution darf nur arbeiten, wer älter ist als 18 Jahre, eine Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung besitzt und die gesetzlichen Rahmenbedingungen wie Strichzonenpläne einhält. Zuhälter und Bordellbesitzer machen sich strafbar, wenn sie die Prostituierten bei der Arbeit überwachen und sie nicht frei entscheiden lassen, welche Freier sie bedienen wollen. Sie dürfen der Prostituierten kein Geld abnehmen und niemanden zur Prostitution zwingen. Wenn ein Freier das Gefühl hat, dass eine Prostituierte Opfer von Menschenhandel wurde, kann er ihr unter anderem helfen, indem er der Frau das eigene Handy ausleiht, damit sie sich bei einer Beratungsstelle melden kann. Der Freier kann sich auch selber bei einer Beratungsstelle melden und sich Infomaterial besorgen, das er der Frau später übergeben kann. Mehr Informationen zu Prostitution ohne Zwang und Gewalt: www.verantwortlicherfreier.ch.
Der «Sonntagsblick» publizierte am Wochenende Zahlen, die den Kanton Aargau schlecht dastehen lassen. Sie zeigen: Wenn es um den Kampf gegen Menschenhandel im Schweizer Sexarbeitsmarkt geht, dann hinkt der Aargau den meisten anderen Kantonen hinterher. Der Aargau steht auf Platz vier im schweizweiten Vergleich, wenn es um die Zahl der Erotikbetriebe geht. Was die Aufdeckung von Menschenhandel in diesem Milieu angeht, ist der Aargau aber bei den Schlusslichtern.
In den letzten neun Jahren deckten Ermittler in der Schweiz 638 Fälle von Menschenhandel auf. Nur zwei davon im Aargau. In der gleichen Zeit wurden schweizweit 1041 Fälle von illegaler Prostitution aufgedeckt. Im Aargau waren es nur 17. Besonders augenfällig ist das im Vergleich mit dem Nachbarskanton Solothurn. Dort wurden 79 Fälle von Menschenhandel aufgedeckt und 112 Fälle von Prostitution. Was läuft schief im Aargau?
Wenig Personal, viel Arbeit
Die Antwort kommt schnell und ist einfach. Es fehle an Personal. «Der Kanton Aargau verfügt über die kleinste Kantonspolizei im Verhältnis zur Wohnbevölkerung. Weil die Ermittlungen im Bereich Menschenhandel sehr aufwendig sind, ist es schwer, genug Personal dafür einzusetzen», fasst Mediensprecher Samuel Helbling vom Departement für Volkswirtschaft und Inneres zusammen.
Das Problem sei aber bekannt, und es gebe konkrete Pläne, um in Zukunft mehr Fälle aufzudecken. «Bei den Strafverfolgungsbehörden sind weitere Sensibilisierungsmassnahmen sowie interne und externe Weiterbildungen geplant. Erste Veranstaltungen und Weiterbildungen haben bereits stattgefunden», so Helbling. Im April hätten sich Fachpersonen der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft aus dem Kanton Zürich mit Vertretern aus dem Aargau getroffen. «Sie haben von ihren Erfahrungen berichtet und den Behörden des Kantons Aargau wertvolle Informationen und Tipps gegeben».
Zudem wollen verschiedene Stellen des Kantons intensiver zusammenarbeiten und haben deshalb eine Kooperationsvereinbarung verabschiedet. Kooperationspartner sind die Kantonspolizei, das Amt für Migration und Integration, die Staatsanwaltschaft, der kantonale Sozialdienst und die Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ).
Die Fachstelle arbeitet bereits mit verschiedenen Kantonen zusammen, unter anderem mit Solothurn, und ist zufrieden mit der Entwicklung im Aargau. «Wir spü- ren bei den Beteiligten eine grosse Motivation», betont Rebecca Angelini von der Fachstelle. Florian Vock, SP Grossrat und Mitglied der Kommission für öffentliche Sicherheit (SIK), begrüsst die Bemühungen des Kantons. «Bei so einem schweren Tatbestand wie Menschenhandel darf sich die Polizei nicht zurückhalten.» Mangelnde Ressourcen will er als Ausrede nicht gelten lassen. «Die Polizei kann sich mit der Kommission in Verbindung setzen und mehr Ressourcen beantragen.»
Proaktiv statt repressiv
Wichtig ist laut Angelini, dass die Polizei in Zukunft nicht rein repressiv im Milieu arbeitet, sondern proaktiv ermittelt wird. Bei rein repressiven Kontrollen werden lediglich die Papiere der Arbeiterinnen überprüft. «Die Frauen nehmen die Polizei so als Bedrohung wahr, von der sie gebüsst, aber nicht geschützt werden», erklärt Angelini. Damit sei es fast unmöglich, dass sie mit der Polizei kooperieren. Bei der proaktiven Ermittlung gehe es dagegen darum, das Vertrauen der Frauen zu gewinnen. «Opfer von Menschenhandel wenden sich nur an die Polizei, wenn sie wissen, dass sie keine Angst haben müssen, als Täterinnen behandelt zu werden.» Und dann, so ist Angelini überzeugt, «stellt sich auch der Ermittlungserfolg ein». Wichtig sei zudem die Zusammenarbeit zwischen Opferschutz und Polizei. «Wenn eine Frau aussagen will, dann muss sie geschützt werden.»





